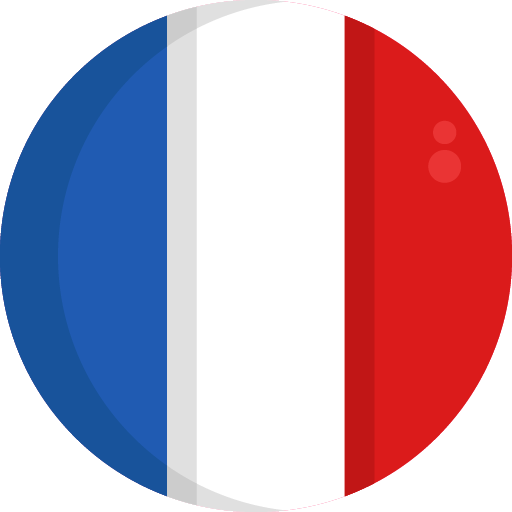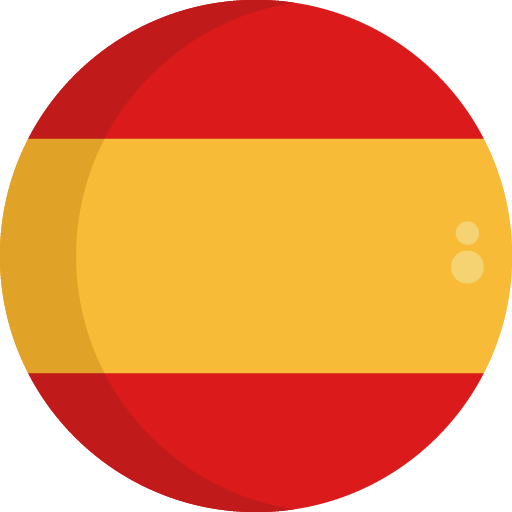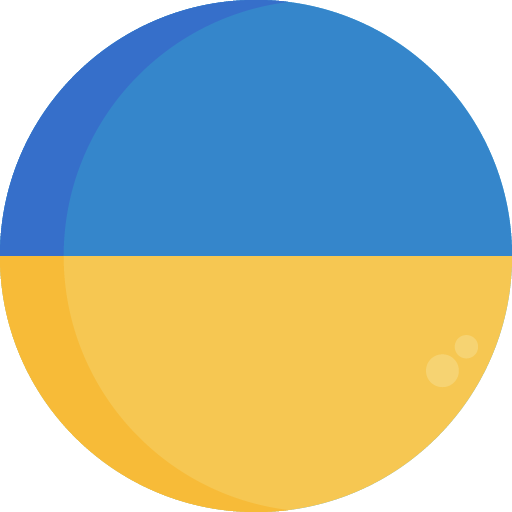Essay #04
Formkritik
Das Wesen der Formkritik
Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts trat eine neue Form der Evangelienkritik auf den Plan, die Formkritik. Die Quellenkritik versuchte, das Problem der Synoptik zu lösen, indem sie die Evangelien im Hinblick auf Quellendokumente analysierte, von denen die Verfasser der Evangelien abhängig gewesen sein sollen. So ging die Quellenkritik im Allgemeinen davon aus, dass Markus das älteste Evangelium war und dass Matthäus und Lukas auf Markus und eine weitere angebliche schriftliche Quelle, bekannt als Q, zurückgriffen. Auf diese Weise wurden die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Synoptikern erklärt. Die Formkritiker akzeptierten größtenteils irgendeine Form der Quellenkritik, aber sie gaben sich nicht damit zufrieden, die Sache auf sich beruhen zu lassen.
Die Gründe für diese Unzufriedenheit sind gewichtig. In ihrem Bestreben, alle Phänomene der Synoptiker zu erklären, sahen sich die Quellenkritiker gezwungen, die hypothetischen Schriftquellen zu vermehren, was die Theorie an sich schon als adäquate Lösung diskreditierte. Außerdem konnte die Quellenkritik, als literarische Methode, die schriftlichen Originalquellen nicht verdrängen. Diese entstanden erst mindestens zwanzig Jahre nach dem Tod von Jesus. Welchen Status hatte die Evangelienüberlieferung während dieser Zeit? Darüber hinaus stellten W. Wrede u.a. die Historizität der Markus-Erzählung in Frage, indem sie argumentierten, dass der Rahmen der Markus-Erzählung eine eigene Schöpfung des Autors sei. Markus könne daher weder chronologisch noch geographisch als zuverlässig angesehen werden; Markus und die von ihm abhängigen Personen seien biographisch nicht korrekt. Mit der Zerstörung der Integrität des chronologisch-geographischen Rahmens der Synoptiker wurden die Einheiten des Evangelienmaterials, die durch diesen Rahmen miteinander verbunden waren, isoliert und einer eigenständigen kritischen Analyse unterzogen.
Die Absicht der Formkritik ist es, diese Einheiten der Evangelienüberlieferung während der zwanzigjährigen mündlichen Periode zu untersuchen, bevor sie zu den ersten schriftlichen Quellen wurden, die von den Quellenkritikern vorgeschlagen wurden. Formkritiker versuchen, dieses Material in Formen mündlicher Überlieferung zu klassifizieren und die historische Situation (Sitz im Leben) innerhalb der frühen Kirche zu entdecken, die zu jeder dieser Formen geführt hat. Mit anderen Worten, die Formkritik akzeptiert im Allgemeinen die Quellenkritik so weit wie möglich, aber die Formkritik zielt darauf ab, die Untersuchung der Ursprünge des Evangeliums über die schriftlichen Quellen hinaus in die mündliche Zeit zu verlagern. Die Neutestamentler, die am ehesten als Formkritiker identifiziert werden können, sind Martin Dibelius, Rudolf Bultmann, Burton S. Easton, Frederick C. Grant, Edwin B. Redlick, R. H. Lightfoot, Vincent Taylor und D. E. Nineham.
Aber selbst diese führenden Vertreter vertreten sehr unterschiedliche Standpunkte. Für einige Formkritiker ist die Untersuchung der Formen des Evangelienmaterials lediglich eine Frage der literarischen Analyse. Am anderen Ende der Skala stehen diejenigen, deren Theorien sehr spekulativ sind und die dem historischen Wert des Materials skeptisch gegenüberstehen. Für diese Forscher sind die Überlieferungseinheiten Produkte der frühchristlichen Gemeinschaft. Die Inhalte spiegeln im Allgemeinen eher das Leben und die Lehre der frühen Kirche wider als das Leben und die Lehre Jesu. Die Formen, in die die Inhalte gegossen sind, geben Hinweise auf ihren relativen historischen Wert. Auch unter den Formkritikern gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, in welche Formen die Überlieferungseinheiten gegossen sind, wie sie zu benennen sind und welche Bedeutung den einzelnen Formen zukommt. Dibelius sprach von Paradigmen, Erzählungen, Legenden, Redewendungen und Mythen. Bultmann teilte das überlieferte Material in drei große Kategorien ein: Wundergeschichten, Apophthegmata (Äußerungen von Jesus, die aus Kontroversen nach seinen Wundern hervorgingen) und Aussagen von Jesus.
Eine Analyse und ein Vergleich der formkritischen Theorien zur Klassifizierung und Interpretation würde eine detaillierte Diskussion erfordern, die den Rahmen dieses Essays sprengen würde. Für eine Bewertung der Formkritik ist eine solche Diskussion jedoch nicht erforderlich. Um zum Kern der Sache vorzudringen, ist es notwendig, die Grundannahme der Formkritik, wie sie von Dibelius und Bultmann verkörpert wurden, zu evaluieren. Wenn das Fundament der radikalen Formkritik keinen Halt hat, macht es wenig Sinn, sich ernsthaft mit den Einzelheiten ihres Überbaus zu befassen. Und wenn die Formkritik nur als eine werturteilsfreie Methode der literarischen Analyse betrachtet wird, gibt es keinen Grund, viel Aufhebens darum zu machen.
Was aber ist die Grundannahme der Formkritik? Sie lautet, dass die Formtradition zunächst als kurze Erzählungen existierte, die mündlich in der christlichen Gemeinschaft zirkulierten, und dass ihre kontextuellen Verbindungen in den Evangelien Schöpfungen der Evangelisten sind. Diese Hypothese könnte an sich unproblematisch sein. In der Tat entspricht sie, wenn sie so formuliert wird, fast der Theorie der mündlichen Überlieferung über die Entstehung der Evangelien. Aber der gründliche Formkritiker meint mit dieser Annahme etwas ganz anderes. Er oder sie meint, dass die christliche Urkirche nicht nur die Berichte über die Worte und Taten Jesu überliefert hat, sondern dass sie diese Überlieferung auch gestaltet und verändert hat, um sie ihren eigenen, sich wandelnden Perspektiven und Bedürfnissen anzupassen. Sie erfand sogar neue Worte und Taten Jesu, wenn es die Umstände erforderten. Die Evangelisten ihrerseits übernahmen die Einheiten der Überlieferung mit kleinen Anpassungen oder Veränderungen. Um dem Zweck ihrer Werke zu dienen, arrangierten sie das Material in einem künstlichen Kontext.
Diese Annahme enthält zwei Schlüsselelemente. Erstens geht sie davon aus, dass es der frühchristlichen Gemeinschaft so sehr an echtem biographischen Interesse und Ehrlichkeit mangelte, dass sie bewusst die Fakten änderten und so die Tradition schufen, die sie weitergaben. Dies geschah angeblich, um bestimmte Bedürfnisse innerhalb der Gemeinschaft zu befriedigen. Diese Bedürfnisse sollen sich nun in den verschiedenen Formen, die die Überlieferungseinheiten angenommen haben, widerspiegeln. So werden die Evangelien zu primären Wissensquellen über das Leben der frühen Kirche und nur zu sekundären Quellen über die Worte und Taten Jesu. Das zweite Element der Annahme ist, dass die Evangelisten lediglich Redakteure dieser einzelnen, isolierten Überlieferungseinheiten waren (auch wenn ihren redaktionellen Veränderungen bis zum Aufkommen der Redaktionskritik wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde; siehe Essay #05 – Redaktionskritik). Ohne Rücksicht auf die historische Realität arrangierten und ordneten sie das Material für ihre eigenen Zwecke um. Praktisch alle Orts- und Zeitangaben, die die einzelnen Einheiten miteinander verbinden, gelten als redaktionelle Schöpfungen und damit als historisch unzuverlässig. Diese Sicht der frühen Kirche und der Evangelienschreiber ist aufgrund einer Reihe von Schwächen, die in der folgenden Diskussion dargelegt werden, ernsthaft in Frage zu stellen.
Die Zeugnisse der Augenzeugen
Der erste und offensichtlichste Faktor, der bei der Beurteilung der Formkritik zu berücksichtigen ist, sind die Zeugnisse der Augenzeugen des Lebens Jesu. Das Versagen dieser Disziplin, die Rolle der Augenzeugen in der frühen Kirche angemessen zu berücksichtigen, reicht aus, um ihre Grundannahme und ihre Implikationen zu diskreditieren. Das Vorhandensein von Augenzeugen bedeutet, dass es keine „schöpferische“ Gemeinschaft gegeben haben kann, die die Überlieferung nach ihren eigenen Bedürfnissen gestaltet und umgestaltet hat, ohne sich um die leicht zugänglichen Fakten zu kümmern.
In der Tat sehen Formkritiker das Christentum abgeschnitten von ihrem Gründer und seinen Jüngern. Dies geschieht durch eine unerklärliche Annahme der Ignoranz und des Schweigens der damaligen Zeitzeugen. Die neue Sekte musste für die Worte Jesu Situationen erfinden und ihm Worte in den Mund legen, die das Gedächtnis nicht verifizieren konnte und die er vielleicht gar nicht gesagt hatte. Aber die esten Jünger und Leiter der Bewegung, die gehört und gesehen hatten was sie berichteten (Apg 2,1-4), lebten noch zur Zeit der Urgemeinde. Der Formkritiker vergisst oder ignoriert die Tatsache, dass Jesus eine Mutter und Jünger hatte, die viele lebendige Erinnerungen an sein Leben und Wirken hatten. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die in Markus 3,31-35; 4,10; 15,40; und 16,1-8 erwähnten Personen sich nicht an Jesus erinnerten.
Mit ihrer Theorie stellen die Formkritiker die Integrität der Jünger in Frage, die Jesus gesehen und gehört haben und sogar persönlich an seinem Wirken beteiligt waren. Wenn die Formkritiker Recht haben, dann hatten die Jünger keine Kontrolle über die Richtigkeit der Überlieferung. Das kann aber kaum der Fall gewesen sein. Ist es denkbar, dass die frühe Kirche in ihren eigenen Diskussionen und Auseinandersetzungen zweifelhafte Aussagen über das Wirken Jesu nicht geprüft hat? Wenn die Kirche solche Aussagen tatsächlich nicht geprüft hat, warum gibt es dann eine so große Übereinstimmung über das Wesen und die Einzelheiten dieses Wirkens? Eine rein phantasievolle Gemeinschaft ohne Unterscheidungsvermögen hätte keine kohärente Tradition bilden können. Die Überlieferung musste von Augenzeugen innerhalb der Kirche kontrolliert werden.
Ebenso wichtig ist die Tatsache, dass auch Gegner des Christentums außerhalb der Kirche Augenzeugen des Wirkens Jesu waren. Ist es auch hier möglich, dass die Gegner es zuließen, dass falsche Aussagen über sein Leben, so wie sie es kannten, als Tatsachen ausgegeben wurden? Das Christentum wäre hoffnungslos verwundbar geworden, wenn es Geschichten erfunden hätte, um sich selbst zu erhalten. Petrus sagte nicht nur: „Wir alle sind Zeugen“ (Apg 2,32), sondern er sagte auch zu den Männern Israels: „Ihr selbst wisst es“ (Apg 2,22).
Das biografische Interesse der Gemeinschaft
Die Annahme der Formkritik, die urchristliche Gemeinde sei phantasievoll gewesen, übersieht nicht nur die Augenzeugen, die die Richtigkeit der sich entwickelnden Tradition hätten überprüfen können, sondern, als zweite Schwäche, auch die Tatsache, dass die frühe Kirche die Richtigkeit der Tradition sicherlich hätte bewahren wollen. Mit anderen Worten: Die frühe Kirche hatte durchaus ein biographisches Interesse am Leben Jesu. Die Formkritik, die das Gegenteil behauptet, führt an, die frühen Christen seien so sehr von der Möglichkeit der Wiederkunft von Jesus eingenommen gewesen, dass sie sich nicht für die Fakten seines Lebens interessiert hätten. Es ist jedoch unvorstellbar, dass die Erinnerungen an Jesus nicht sorgfältig und genau aufgezeichnet wurden. Es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass die frühe Kirche mit anderen Interessen beschäftigt war. Vielmehr spricht alles für das Gegenteil.
Wenn sie kein biographisches Interesse an Jesus hatten, warum unterschied Paulus dann zwischen seinen Worten und den Worten des Herrn (1 Kor 7,10 ,12 ,25)? Warum haben viele zur Feder gegriffen, um die Ereignisse im Leben Jesu zu schildern, und warum haben sie Augenzeugenberichte verwendet (Lk 1,1-2)? Warum fügte Lukas nach sorgfältigen Recherchen dieser Sammlung seinen eigenen präzisen Bericht über das Wirken des Herrn hinzu (Lk 1,3-4)? Warum beriefen sich die ersten Christen immer wieder darauf, Augenzeugen der Ereignisse gewesen zu sein, von denen sie sprachen (Apg 2,32; 3,15; 10,41)? Formkritiker müssen den lukanischen Prolog und die Apostelgeschichte gründlich diskreditieren, wenn sie das biographische Interesse der Urgemeinde ausschließen wollen.
Neben den Augenzeugenberichten, von denen die Apostelgeschichte erzählt, beweist sie auch direkt, dass die frühe Kirche ein biographisches Interesse hatte, das über die Passionsgeschichte hinausging. Dies zeigt sich in der Wahl des Matthias zum Stellvertreter des Judas (Apg 1,21-22), in der Pfingstpredigt des Petrus (Apg 2,12-24), in den Worten des Petrus an das Haus des Kornelius (Apg 10,36-43) und in der Botschaft des Paulus an Antiochia in Pisidien (Apg 13,23-31). Im Gegensatz zu dem, was die Formkritiker behaupten, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die ersten Christen ein intensives Verlangen hatten, von Jesus zu hören. Der Formkritiker übersieht, dass die Person Jesu im Zentrum des christlichen Glaubens steht. Dieser Glaube wäre sinnlos, wenn man nicht ein genaues Bild von ihm hätte. Der Glaube an Christus ist zentral, aber er ist unmöglich ohne das Wissen, wer und was er war. So ist der historische Jesus, der mit dem Christus des Christentums identisch ist (und nicht nur ein Schatten von ihm, wie der Formkritiker meint), der Kern der christlichen Botschaft, wer immer sie auch verkündet haben mag (vgl. Apg 2,32; 3,12-26; 4,10-20; 5,30-32; 8,35).
Die Unmöglichkeit einer kreativen Gemeinschaft
Eine dritte Schwäche der formkritischen Grundannahme besteht darin, dass sie die Vorstellung einer kreativen, schöpferischen Gemeinschaft impliziert, d.h. die christliche Urgemeinde hätte die Macht gehabt, die Jesusüberlieferung nach ihren eigenen Bedürfnissen zu schaffen und zu verändern.
Für den Formkritiker ist Jesus eine schwache und ferne Gestalt. Die Gemeinschaft war angeblich jederzeit bereit, neue Inhalte zu schaffen oder bestehende zu korrumpieren. Aber kann das wirklich so gewesen sein? So markante und pointierte Sätze, wie sie in den Evangelien überliefert sind, stammen nicht von Gemeinschaften, sondern von Einzelnen. Dieser Einzelne kann in diesem Fall nur Jesus gewesen sein. Die Aussagen müssen auch nicht notwendigerweise hellenistischen oder rabbinischen Quellen entnommen und Jesus in den Mund gelegt worden sein. Gelegentliche Ähnlichkeiten der Lehren Jesu mit Lehren aus anderen Quellen sind kein Beweis für eine Übernahme durch die frühe Kirche. Auch große Lehrer können und dürfen schon Bekanntes aussprechen.
Nehmen wir jedoch an, der Argumentation willen, dass die Gemeinschaft die Neigung hatte, eine Tradition über Jesus zu schaffen, einschließlich seiner Reden und Geschichten über ihn. Woher nahm die Gemeinschaft dann die Weisheit, das Beste auszuwählen? Dass eine solche Auswahl getroffen werden musste, geht aus der Kohärenz der synoptischen Überlieferung hervor. Es gibt keinen Widerspruch zwischen der Lehre und den Taten Jesu. Die Geschichte des Evangeliums ist von Anfang bis Ende durch eine logische und chronologische Abfolge gekennzeichnet. Die Genauigkeit der Beschreibungen des zeitgemässen Israels wird anerkannt. Wäre die frühe Kirche jedoch „kreativ“ gewesen, hätte sie keinen Standard gehabt, der sie bei der Auswahl hätte leiten können, um eine so harmonische Überlieferung zu schaffen.
Die Unmöglichkeit einer solchen schöpferischen Kirche wird durch die Feststellung bewiesen, dass die Geschichte des Evangeliums die Gemeinschaft geschaffen hat und nicht umgekehrt. Anders ausgedrückt: Wenn der urchristliche Glaube die Evangelien geschaffen hat, was hat dann den christlichen Glauben geschaffen? Die Vorstellung einer schöpferischen Gemeinschaft, die für die Entstehung der synoptischen Überlieferung verantwortlich ist, setzt die quasi spontane Entstehung eines organisierten religiösen Lebens voraus, das auf dem intensiven Glauben an die Gottheit eines gekreuzigten Juden beruht, und das alles ohne den dominierenden Einfluss von Jesus oder einer anderen Person. Eine solche Spekulation widerspricht jedoch den Tatsachen.
Die Beweise für zuverlässige historische Zusammenhänge
Eine vierte Schwäche zeigt sich, wenn man feststellt, dass die Formkritiker die Zuverlässigkeit der historischen Kontexte in Frage stellen, in die die Überlieferungseinheiten eingebettet sind. In der Tat besteht ihre erste Aufgabe darin, die Einheiten von angeblich künstlichen Kontexten zu befreien. Die Behauptung einer solchen Künstlichkeit ist jedoch unbegründet. Der Charakter der Evangelien selbst legt den gegenteiligen Schluss nahe.
Um die Vorstellung künstlicher Zusammenhänge zu untermauern, behaupten Formkritiker, die meisten historischen, geographischen, chronologischen und biographischen Bezüge in den Evangelien seien fiktive Mittel, mit denen die Evangelisten isolierte Überlieferungseinheiten zusammengefügt hätten. Eine Untersuchung der Orts-, Zeit-, Reihenfolge- und Personenangaben zeigt jedoch, dass sie so eng mit dem übrigen Material der Einheiten verwoben sind und für sich genommen eine so natürlich geordnete Abfolge bilden, dass es höchst spekulativ ist, sie als redaktionelle Schöpfungen der Evangelisten zu betrachten. Sowohl die Zusammenhänge als auch die Aussagen und Ereignisse sind in der Geschichte verwurzelt.
Das Markusevangelium ist dafür ein gutes Beispiel. Eine genaue Untersuchung seiner Abfolge und seiner chronologischen und geographischen Notierungen zeigt eine natürliche und nicht künstliche Integration und Entwicklung, die durch enge Parallelen mit den Umrissen oder Teilumrissen der Evangeliumsgeschichte in der Apostelgeschichte bestätigt wird. Diese Erzählungen umfassen den Zeitraum von der Verkündigung Johannes des Täufers bis zur Auferstehung Christi und legen einen besonderen Akzent auf die Passionsgeschichte (vgl. Apg 10,37-40; 13,23-31). Das ist der Kern der Botschaft der Urkirche. Genau dies ist auch der Umfang des Markusevangeliums.
Die wahre Bedeutung der stereotypen Formen
Es ist kaum zu leugnen, dass einzelne Teile der Evangelien in der frühen Kirche ursprünglich als isolierte Einheiten zirkulierten. Selbst Formkritiker erkennen an, dass die Passionsgeschichte als eine lange, zusammenhängende Erzählung existierte. Warum nicht auch andere zusammenhängende Abschnitte wie Markus 1,21-39 und 2,1-3,6 anerkennen? Das synoptische Material zeigt, dass es wahrscheinlich einige stereotype Formen gab, auch wenn das Ausmaß dieser Formen von den Formkritikern übertrieben wurde. Die eigentliche Frage lautet: Weisen die stereotypen Formen auf bestimmte historische Situationen (Sitz im Leben) der Kirche hin, in denen die jeweilige Form entstanden ist, um bestimmten Bedürfnissen dieser Urkirche zu entsprechen? Mit anderen Worten, weisen diese Formen manchmal auf die Ungeschichtlichkeit dessen hin, was erzählt wird?
Die Antwort auf diese Frage kann nur ein entschiedenes Nein sein, und darin liegt eine fünfte Schwäche der Formkritik. Die Form verleiht dem Textmaterial keinen relativen historischen Wert. Die Form hat nichts mit Wahrheit oder Unwahrheit zu tun. Aus stereotypen Formen lässt sich nichts anderes ableiten, als dass die Kirche Episoden auf eine bestimmte Weise zu erzählen pflegte oder dass Jesus nach bestimmten Mustern lehrte.
Die Wundergeschichten würden natürlich ähnlich erzählt werden, da die Rahmenbedingungen und Ereignisse wahrscheinlich die gleichen sind. Dasselbe gilt für die Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Was die poetische Form vieler Aussagen Jesu betrifft: Was wäre für ihn, der zu Juden sprach, natürlicher gewesen, als seine Aussagen in poetischer Form zu formulieren? Das war in der Tat der normale semitische Stil. Diese Praxis erleichterte es seinen Anhängern, ob Juden oder Nichtjuden, sich an seine Worte zu erinnern. Es ist ebenso sinnvoll, vielleicht sogar sinnvoller, zu sagen, dass der eigentliche Urheber der Jesus zugeschriebenen Sprechformen er selbst ist.
Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Formkritik als Methode zur Untersuchung der synoptischen Evangelien in fünf Punkten versagt: Sie berücksichtigt nicht die Zeugnisse der Augenzeugen, sie erkennt das biographische Interesse der Gemeinschaft nicht an, ihre Theorie einer kreativen Gemeinschaft ist unmöglich, sie stellt die Beweise für die Zuverlässigkeit der historischen Kontexte der Evangelien in Frage, und ihre Schlussfolgerungen über den historischen Wert basieren auf stereotypen Formen.
Dr. Robert L. Thomas
Dr. Stanley N. Gundry
Weiterführende Literatur
Bultmann, Rudolf. History of the Synoptic Tradition. New York: Harper & Row, 1963.
Dibelius, Martin. From Tradition to Gospel. New York: Scribner’s, 1935.
____. Gospel Criticism and Christology. London: Nicholson and Watson, 1935.
Easton, Burton Scott. The Gospel Before the Gospels. New York: Scribner’s, 1928.
Gundry, Stanley N. “A Critique of the Fundamental Assumption of Form Criticism,” Bibliotheca Sacra 123 (1966): 32-39, 140-49.
Guthrie, Donald. New Testament Introduction. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1970. Pp. 188-219.