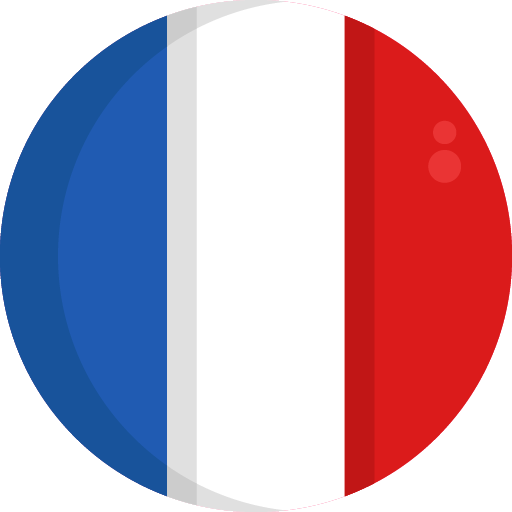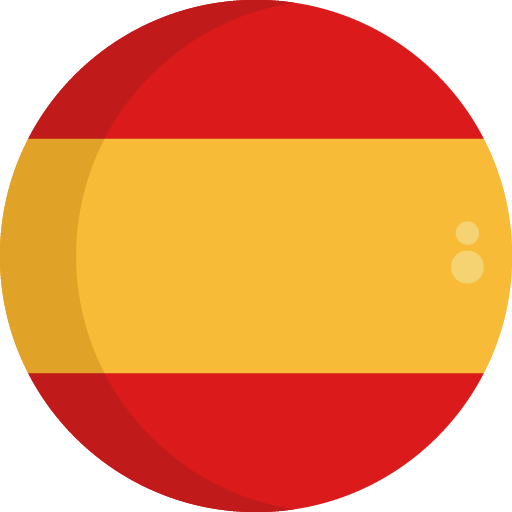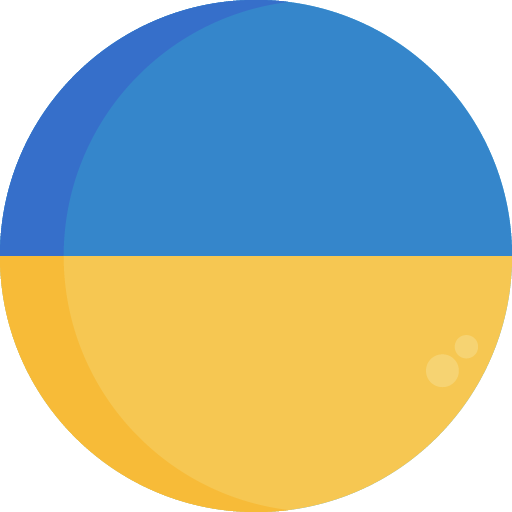Essay #05
Redaktionskritik
So wie die Formkritik als Weiterentwicklung der Quellenkritik entstanden ist, hat die Formkritik ihrerseits eine weitere Teildisziplin, die Redaktionskritik, hervorgebracht. Angesichts der großen Aufmerksamkeit, die den synoptischen Evangelien und der Ekklesiologie (Gemeindetheologie) geschenkt wurde, stellte sich nicht die Frage, ob, sondern wann sich die neutestamentliche Forschung wieder den Redaktoren der Evangelien zuwenden würde, die Matthäus, Markus und Lukas zusammengestellt hatten. Obwohl die Redaktionskritik nicht sofort als von der Formkritik getrennt anerkannt wurde, hat sie schließlich den Status einer eigenständigen Disziplin erlangt.
Gegenüber der Formkritik konzentriert sich die Redaktionskritik vor allem auf die Theologie der Evangelisten im Unterschied zur Theologie der christlichen Gemeinschaft. Eine klare Trennlinie zwischen beiden ist nicht leicht zu ziehen. In einigen Fällen müssen sogar Überschneidungen eingeräumt werden. Da die Verfasser der Evangelien Teil der Gemeinschaft waren, spiegeln sie zwangsläufig zumindest teilweise die theologische Haltung dieser Gemeinschaft wider. Wäre dies nicht der Fall, müssten die Verfasser der Evangelien von den Menschen, denen sie dienten, unnatürlich getrennt werden.
Die Redaktionskritiker lehnen die traditionellen Ansichten über die Verfasserschaft der Evangelien weitgehend ab. Sie sehen die Verfasser der Synoptiker als spätere theologische Redaktoren, denen aus Prestigegründen die Namen Matthäus, Markus und Lukas angedichtet wurden. Diese anonymen Autoren sind es also, deren theologische Ansichten in dieser Art von Forschung in Frage gestellt werden. Man geht davon aus, dass sich diese Ansichten von jeder spezifischen und systematischen Lehre Jesu unterscheiden.
Die Herausbildung der Redaktionskritik als eigenständige Disziplin geht auf die Mitte des 20. Jahrhunderts zurück. Zu den prominentesten Vertretern der ersten Stunde zählen Gunther Bornkamm, Hans Conzelmann und Willi Marxsen. Jeder von ihnen konzentrierte sich auf ein Evangelium. Bornkamm auf Matthäus, Conzelmann auf Lukas und Marxsen auf Markus. In der folgenden Diskussion werden diese drei zusammen mit Werner Kummel und Norman Perrin die Vertreter der Redaktionskritik sein.
Theologie von Markus
Da die Zweiquellentheorie und die Formkritik dem Markusevangelium den Vorrang einräumen, gilt dies auch für die Redaktionskritik. Dieses Evangelium ist daher ein geeigneter Ausgangspunkt für die theologische Analyse. Die redaktionelle Analyse des Markusevangeliums ist schwieriger, da die vom Verfasser benutzten Quellen nicht zur Verfügung stehen. Nach Marxsen sammelt, bearbeitet und erweitert Markus einzelne Überlieferungseinheiten nach vier Richtlinien:
- Durch die Hinzufügung von Vorhersagen über sein Kommen verbindet er die Passionsgeschichte mit dem Rest.
- Er erfindet die Theorie des messianischen Mysteriums, um das späte (nachösterliche) Aufkommen der messianischen Lehre zu erklären.
- Er führt den neuen literarischen Begriff euangelion (Evangelium) ein. Es ist die „Verkündigung einer Heilsbotschaft“ und geht auf Paulus zurück.
- Er webt Galiläa, als geographische Orientierung, in die Erzählung ein. Die daraus resultierende Kraft des Evangeliums ist also nicht ein historischer Bericht über das Leben von Jesus, sondern eine Verkündigung des Heils, das die Christen nach der österlichen „Erfahrung“ (d.h. der Auferstehung) erwarten. Der Evangelist nimmt die baldige Wiederkunft Christi vorweg und fordert seine Leser auf, sich auf den Weg nach Galiläa zu machen, wo er die parousia (Ankunft) erwartet.
Theologie von Matthäus
Für den Redaktionskritiker sind die Theologien von Matthäus und Lukas leichter zu erkennen, da diese Evangelien auf einer bekannten Quelle (Markus) und einer rekonstruierten Quelle (Q) beruhen. Bornkamm geht davon aus, dass Matthäus in den 80er oder 90er Jahren
n. Chr. irgendwo zwischen Israel und Syrien entstanden ist. Das Buch spiegelt eine tiefe Spaltung zwischen Judentum und Christentum wider, genauer gesagt eine innerkirchliche Spaltung zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Dieser Evangelist, der sich auf die Seite der Heiden stellt, ordnet seine Quellen (Markus und Q sowie einige spezifische matthäische Texte) und fügt ihnen Material hinzu, um einen Lehrer zu schaffen, der das wahre Wesen des Gesetzes erfasst hat, das dem pharisäischen Judentum entgangen war. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern lehrte dieser „Rabbi“ mit einer Autorität, die sich auf Wunder stützte, und seine Schüler hörten nie auf, Schüler zu sein. Obwohl dieses neue System viele Gemeinsamkeiten mit dem Judentum aufweist, unterscheidet es sich doch von ihm und verdient seinen eigenen Titel ekklesia (Gemeinschaft/Kirche), ein Begriff, den die christliche Gemeinde dem irdischen Jesus in den Mund gelegt hat. Die Kirche ist universal geworden und nicht mehr lokal wie die jüdische Synagoge. Die Gegenwart Gottes in seiner Kirche ersetzt das Gesetz und den Tempel als verbindende Elemente. Dennoch hat die Kirche ihre endgültige Vollkommenheit noch nicht erreicht. Es besteht weiterhin die Notwendigkeit, die Lehren von Jesus im Hinblick auf das kommende Gericht zu befolgen, das zur verheißenen Erlösung führen wird.
Die ausschließliche Konzentration des Markus auf die baldige Wiederkunft Christi wurde im Matthäusschema durch eine gemeinsame Betonung von Ekklesiologie und Eschatologie ersetzt. Das christliche Denken des späten ersten Jahrhunderts setzte sich mit der Tatsache auseinander, dass die Wiederkunft des Messias nicht unmittelbar erfolgen würde, und entwickelte daher das Konzept einer neuen Institution, der Kirche, die die Zeit bis zur Wiederkunft überbrücken sollte.
Theologie von Lukas
Nach Conzelmann beschreibt Lukas, der etwa zur Zeit des Matthäus oder später schreibt (vielleicht um 90 n. Chr. oder später), drei verschiedene Zeitabschnitte: die Zeit Israels, die Zeit des Wirkens Jesu und die Zeit nach der Himmelfahrt. Der zweite und der dritte Zeitabschnitt werden von diesem Autor getrennt. Die erste Zeit, in der Jesus lebte und auf Erden wirkte, war die Zeit des Heils, in der Satan fern war und es keine Versuchung gab. Seit dem Leiden Jesu ist Satan jedoch zurückgekehrt und die Versuchungen sind sehr real. Das Wirken des Geistes in der Kirche wird im Wesentlichen als Erfüllung der Prophezeiungen über die „letzten Tage“ dargestellt. Lukas spiegelt also eine allgemeinere, abgeschwächte eschatologische Erwartung in der Kirche seiner Zeit wider. Die Verzögerung der Wiederkunft Christi ist also das Motiv des Lukas.
Das bedeutet, dass Lukas den Schwerpunkt von der kurzen Zeit des Wartens seiner Vorgänger auf ein längeres christliches Leben verlagert. Diese Verlagerung führt zur Entwicklung ethischer Normen, unter denen die Beharrlichkeit eine herausragende Rolle spielt. Sie führt auch zur Entwicklung eines umfassenden Heilsplans und zur Ersetzung des unmittelbaren Endes durch ein „unendlich“ entferntes Ende.
Charakteristik der Methode
Zum besseren Verständnis der Redaktionskritik sollen einige ergänzende Bemerkungen beitragen:
- Die folgenden Beispiele zeigen, wie die Verfasser der Evangelien ihre theologischen Akzente gesetzt haben sollen:
- In der Erzählung über die Gespräche in Cäsarea Philippi (Mk 8,27-9,1) gibt der Verfasser Fragen und Antworten so wieder, als stammten sie von Jesus und Petrus. In Wirklichkeit, so die Redaktionskritik, entstammen die Titel dem christologischen Vokabular der frühchristlichen Gemeinde. Zudem seien die Figuren zwar nach Personen und Gruppen benannt, die mit dem Wirken Jesu in Verbindung gebracht werden, der Hauptbezug beziehe sich aber auf die Situation der Kirche in den späten 60er Jahren n. Chr. „Jesus“ und seine Worte stehen für Gott im Himmel und seine Botschaft an die Kirche. „Petrus“ steht für die irregeleiteten Gläubigen, die zwar richtig bekennen, aber ihr eigenes Bekenntnis falsch auslegen. „Die Menge“ steht für die Gesamtheit der Gemeindeglieder, für die die Lehre bestimmt ist. Mit anderen Worten: Die Redaktionskritik sieht diese Erzählung in der Form einer Geschichte über Jesus, aber ihr eigentlicher Zweck war die Vermittlung der Botschaft vom auferstandenen Herrn an seine Gemeinde, wie sie von Markus konzipiert wurde. Der historische Eindruck ist nur ein Vehikel und darf nicht mit den tatsächlichen Ereignissen gleichgesetzt werden.
- Matthäus griff denselben Vorfall in Cäsarea Philippi auf und bearbeitete ihn. Aus ekklesiologischem Interesse gestaltet Matthäus die maraskanische Erzählung um, indem er eine feierliche Segnung des Petrus einfügt, aufgrund derer Petrus die volle Autorität als Gründer und Leiter der Urkirche erhält (Mt 16,17-19). Für Matthäus war die Kirche das einzige Medium des Heils. Wer dieser Kirche angehört, ist des Heils gewiss. Matthäus verlegte den Hinweis auf den „Menschensohn“ von 16,21 (vgl. Mk 8,31) nach 16,13, weil er im Gegensatz zu Markus nicht an einer christologischen Diskussion interessiert war. Matthäus ging es um eine formale Verkündigung Jesu über die christliche Kirche.
- In der lukanischen Parallele (Lk 9,18-27) hat Lukas die markinische Dringlichkeit einer baldigen Wiederkunft zugunsten der Betonung eines beständigen Zeugnisses über einen langen Zeitraum hinweg weggelassen. Die Hinzufügung des Wortes „täglich“ in Lukas 9,23 und die Auslassung von „unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht“ und „in Macht gekommen“ in 9,26-27 haben das Erscheinungsbild des Berichtes drastisch verändert. Dies geschah, als Lukas die eschatologische Sicht von Markus überdachte und seine eigene Betonung der Verspätung einführte. Durch die Beachtung solcher Details versucht der Redaktionskritiker, diesen oder jenen theologischen Standpunkt eines Evangelisten zu erfassen.
- Die obigen Beispiele zeigen, wie die Redaktionskritik die Rolle der Evangelienschreiber als die eines Theologen, nicht aber als die eines Historikers begreift. Markus sei völlig von den isolierten Einheiten abhängig gewesen, die von der Formkritik identifiziert wurden. Matthäus und Lukas hatten jeweils Zugang zu eigenen Quellen, die sie zusammen mit Markus und Q verwendeten. Die Aufgabe der drei war es, diese Einheiten so anzupassen und miteinander zu verbinden, wie es ihnen am geeignetsten erschien, um Jesus die Gesichtspunkte und Schwerpunkte zuzuschreiben, die ihnen für die Förderung des Glaubens der Kirche ihrer Zeit am wichtigsten erschienen. Sie waren also theologische Redakteure, aber keine Chronisten historischer Ereignisse. Dass sie Jesus und seinen Gefährten fälschlicherweise viele Dinge zuschrieben, die diese nie gesagt oder getan hatten, war für sie unerheblich. Ihr Hauptanliegen war es, eine Theologie zu konstruieren, die den Bedürfnissen der Kirche entsprach, selbst wenn dies bedeutete, ein Leben Jesu zu erfinden, um dem System mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen.
- Die philosophischen Grundlagen, mit denen der Redakteur versucht, diesem System der Fälschung Respekt zu verschaffen, ähneln denen der Neoorthodoxie von Karl Barth und der Entmythologisierung von Rudolf Bultmann. Neben dem offensichtlichen Bereich der Realität, in dem Raum, Zeit und die physischen Sinne vorherrschen, wird ein weiterer Bereich visualisiert: der Bereich des Glaubens. Alles, wovon man innerlich überzeugt ist, dass es wahr ist, wird als real angesehen, unabhängig davon, ob es eine Tatsache ist. Der Glaube der frühen Christen an die Auferstehung zum Beispiel war so stark, dass er mit den Ereignissen in Raum und Zeit verwechselt wurde, bis zu dem Punkt, an dem viele davon überzeugt waren, dass der physische Körper Jesu vom Tod auferstanden und fortgegangen sei und ein leeres Grab hinterlassen habe. Für den Redaktionskritiker wie für den Formkritiker ist diese geistige Überzeugung nicht falsch, auch wenn die Auferstehung Jesu nicht als historische Tatsache behauptet werden kann. Für ihn ist die Auferstehung eine Glaubenstatsache, die sich für die frühe Kirche bewährt hat, und das genügt. Sie muss nicht mit der Geschichte übereinstimmen. Ebenso müssen die synoptischen Evangelien in ihrer Gesamtheit nicht den historischen Jesus darstellen. Es genügt, dass sie sich für die Entwicklung der urchristlichen Gemeinde als nützlich erwiesen haben.
- Die philosophische Grundlage der Redaktionskritik schließt die Möglichkeit aus, ein Leben Jesu zu rekonstruieren oder eine Theologie Jesu auf der Grundlage der Evangelien zu bestimmen. So wie die Formkritik behauptet, die in den Evangelien berichteten Ereignisse seien Erfindungen der frühen Kirche, so behauptet die Redaktionskritik, die theologischen Lehren in den Evangelien stammten von den einzelnen Schreibern, nicht von Jesus. Die frühen Christen hätten sich nicht von der modernen Vorstellung von „historisch“ (d.h. „faktisch“) leiten lassen. Motiviert durch eine starke religiöse Erfahrung hatten sie keine Skrupel, dem historischen Jesus Worte zuzuschreiben, die er nie gesagt hat. Für den Redaktionskritiker sind die Evangelien und die ihnen zugrundeliegenden Überlieferungen daher in erster Linie ein Spiegel der Erfahrung und Theologie der frühen Kirche. Nur durch die strikte Anwendung wohldurchdachter Authentizitätskriterien könne man hoffen, genaue Angaben über Leben und Lehre Jesu zu erhalten. Und was auch immer in dieser Hinsicht abgeleitet wird, wird bestenfalls minimal sein.
Bewertung
Wer die Redaktionskritik auswertet, wird im Hinblick auf den Nutzen für das Studium der Evangelien nur wenige positive „Nebenprodukte“ feststellen. Als Korrektiv zur Formkritik hat sie zu der Erkenntnis geführt, dass die Verfasser der Evangelien nicht einfach Überlieferungen zusammengetragen haben, sondern dass jeder von ihnen mit einer anderen Intention geschrieben hat, die berücksichtigt werden muss, um die Unterschiede in der Akzentuierung der Evangelien zu verstehen. Das Aufkommen der Redaktionskritik hat auch das Interesse an einer vergleichenden Untersuchung der synoptischen Evangelien neu belebt, das durch die früheren Bemühungen, die drei Evangelien zu einem einzigen Überlieferungsstrang zu verschmelzen, in den Hintergrund getreten war. Darüber hinaus hat seine Suche nach theologischen Motiven die Forscher dazu veranlasst, sich intensiver mit dem Christentum des ersten Jahrhunderts zu beschäftigen. Dies ist insofern von Vorteil, als wir das Neue Testament umso besser verstehen können, je mehr wir über das erste Jahrhundert wissen.
Diese positiven „Nebenprodukte“ sind jedoch von geringem Wert im Vergleich zu den lähmenden Schwächen der Redaktionskritik:
- Die Redaktionskritik basiert auf der Zwei-Quellen-Theorie und auf der Formkritik und erbt daher deren unlösbare Probleme (siehe Essay #03 – Quellenkritik und Essay #04 – Formkritik). Die redaktionelle Methodik ist an denselben Punkten anfällig, und zwar aufgrund der grundlegenden Annahmen, auf denen die Disziplin aufgebaut ist.
- Der Zeitraum, in dem diese theologischen und faktischen Änderungen angeblich vorgenommen und von der Christenheit allgemein akzeptiert wurden, ist unglaublich kurz. Es ist zum Beispiel unmöglich zu glauben, dass die christliche Gemeinschaft die Fakten über das Leben Jesu verändert hat und dass Markus die theologischen Daten, die ihm zugeschrieben werden, erfunden hat, und dass diese weitreichenden Änderungen innerhalb von nur dreißig bis vierzig Jahren in der gesamten Christenheit des ersten Jahrhunderts akzeptiert wurden. In der Antike dauerte es Jahrhunderte, bis die Mythen vereinheitlicht und allgemein akzeptiert wurden.
- Auch die ethische Frage nach dieser Theorie ist unausweichlich. Das Christentum im Allgemeinen und die Verfasser der Evangelien im Besonderen sind bekannt für das hohe System der Wahrhaftigkeit, das sie vertreten. Kann man den Ursprung eines solchen Systems auf Praktiker zurückführen, die das Leben und die Lehren Jesu ausgiebig verfälschten, oder auf Jesus selbst, dessen Worte und Taten, wie sie in den Evangelien zu finden sind, von seinen frühen Anhängern korrekt wiedergegeben wurden? Die letztere Alternative ist bei weitem die überzeugendere.
- Die Redaktionskritiker gehen an die Evangelien anders heran als an andere antike Schriften. Sie gehen zunächst davon aus, dass der größte Teil der Evangelienliteratur nicht historisch ist, als ob die Verfasser der Evangelien durch eine Barriere von jeglichem Interesse an den realen Ereignissen der ersten Hälfte ihres Jahrhunderts getrennt gewesen wären. Sie vermuten, dass Ereignisse und Aussprüche erfunden oder zu theologischen Zwecken umgeschrieben wurden. Dies ist untypisch für den Umgang mit anderen römischen, jüdischen und griechischen Lehrern in der antiken Welt. Die unbeantworteten Gegenbeweise zeigen, dass die frühen Christen ein beträchtliches historisches Interesse an Jesus von Nazareth hatten. Die theologischen Absichten der Autoren waren also nicht von der Geschichte getrennt, sondern in ihr verankert.
- Die philosophische Grundlage der Redaktionskritik ist fraglich. Die Anerkennung einer Reihe von „Glaubensrealitäten“, die im Widerspruch zu den physikalisch beobachtbaren historischen Daten stehen, muss nach einer ernsthaften Analyse abgelehnt werden. Nur ein durch und durch von den Theorien des modernen Rationalismus geprägter Geist kann sich zwei Realitätsbereiche vorstellen, die miteinander in Konflikt stehen, und dennoch beide als gleichwertig betrachten. Eine solche Behauptung stellt das eigene intuitive Verständnis der Wirklichkeit ernsthaft in Frage. Ein solches dualistisches Konzept ist ziemlich künstlich.
- Die Redaktionskritik ist auch gekennzeichnet von einem ungeregelter Subjektivismus. Dies ist ein Auswuchs der dem System zugrunde liegenden Philosophie. Die Redaktionkritiker werden zu ihren eigenen Normen, was oft zu übertriebenen Interpretationen führt. Zum Beispiel muss Marxsens Erklärung von „Petrus“ als Markus’ Darstellung irregeleiteter Gläubiger auf Marxsen zurückgeführt werden, nicht auf Markus (vgl. Markus 8,27-9,1). „Petrus“ könnte in seinem Bekenntnis ebenso gut von jemand anderem als Vertreter der erkennenden Gläubigen verstanden werden. Aus dem Dilemma der unendlich widersprüchlichen Meinungen über Petrus können uns nur die Tatsachen darüber befreien, wer er war. Es muss eine objektive Kontrolle über sie gefunden werden. Mit anderen Worten: Die „Glaubensrealitäten“ müssen auf eine einzige „Glaubensrealität“ reduziert werden, indem die einzige Realität als die historische bestätigt wird. „Petrus“ war entweder eine historische Person oder die Erfindung von jemandem.
Er kann nicht beides sein. Die Meinungsverschiedenheiten unter den Redaktionskritikern spiegeln diese persönliche Voreingenommenheit in ihren Annahmen wider. Dass sie sich ungerechtfertigte Freiheiten herausgenommen haben, wenn sie für unterschiedliche Schwerpunkte bei den einzelnen Autoren argumentieren, könnte nirgendwo deutlicher zum Ausdruck kommen als in ihren Meinungsverschiedenheiten untereinander. Die Theorien über den Zweck des Markusevangeliums gehen beispielsweise davon aus, dass sein Leitfaden die typologische Erfüllung alttestamentlicher Texte, der liturgische Kalender, die Etappen der Offenbarung der messianischen Würde, ein geographisch-theologischer Überblick, die paulinische Theologie usw. ist. Wenn sich die Redaktionskritiker nicht darüber einigen können, welches theologische Thema Markus einführen wollte, ist es wahrscheinlich, dass er gar kein Thema einführen wollte; das theologische Thema stammt aus dem Kopf des modernen Redaktors, nicht aus dem des Evangelienschreibers. Unterschiedliche Grundannahmen verschiedener moderner Gelehrter führen zu unterschiedlichen Meinungen, die dann in das Evangelium zurückgelesen werden. Damit wird den alten Schriften großes Unrecht angetan. - Subjektiv ist auch die Methode der Redaktionskritiker, „authentisches Jesusmaterial“ zu identifizieren. Ihre drei Kriterien – Unterscheidbarkeit, Mehrfachbezeugung und Konsistenz – beruhen auf der Annahme, dass die Jesusüberlieferung viel Unhistorisches enthält. Wenn dies so ist, ist es unmöglich, die historischen Quellen unvoreingenommen zu untersuchen. Das Urteil ist bereits gefällt, bevor der Prozess überhaupt begonnen hat. Die Frage ist nicht, ob der Angeklagte schuldig gesprochen wird, sondern wie und wann er verurteilt wird. Die Redaktionskritik hat also im Voraus festgelegt, was sie herausfinden wird. Das Ergebnis des Prozesses kann daher für die synoptischen Evangelien als historische Dokumente nur verheerend sein.
Evangelikaler Gebrauch der Redaktionskritik
Einige evangelikale Gelehrte haben argumentiert, dass es eine legitime Anwendung der Redaktionskritik gibt, indem sie darauf hinwiesen, dass Redaktion einfach „redigieren“ bedeutet, und indem sie darauf hinwiesen, dass Evangelikale seit langem die redaktionelle Tätigkeit der Verfasser der Evangelien anerkannt haben. Die Redaktionskritik hat vier Kategorien redaktioneller Tätigkeit identifiziert: Selektivität, Anordnung, Veränderung und Kreativität. „Selektivität“ bedeutet, dass die Redaktoren der Evangelien nicht das gesamte Material, das ihnen zur Verfügung stand, aufgenommen haben, sondern das, was für ihre Zwecke am besten geeignet war. „Anordnung“ bedeutet, dass sie ihr Material nicht immer chronologisch, sondern manchmal thematisch geordnet haben, um einen bestimmten Punkt im Leben Christi hervorzuheben. Unter „Veränderung“ wird den Autoren das Recht zugestanden, das Material zu verändern, um es ihren Gewohnheiten oder Zwecken anzupassen. Einige dieser Änderungen waren geringfügig und spiegelten lediglich den individuellen Stil des Autors wider, andere waren tiefgreifender und formten die Berichte in Übereinstimmung mit den theologischen Interessen der Evangelisten und ihrer Gemeinden, anstatt die Situation zur Zeit Jesu genau wiederzugeben. „Kreativität“ bedeutet, dass die Autoren ihre Evangelien kreativ gestalteten, indem sie den historischen Berichten Ereignisse hinzufügten und Jesus Worte in den Mund legten, die der historische Jesus nicht gesagt hatte. Diese kreativen Zusätze wahren die Kontinuität mit den historischen Situationen, die die Berichte beschreiben sollen.
Diese vier Kategorien stellen den normativen Ansatz unter den evangelikalen Vertretern der Redaktionskritik dar. Von der radikalen Redaktionskritik unterscheidet sich die Methodik insofern, als die historische Gültigkeit der synoptischen Evangelien in Frage gestellt wird, aber die Tendenz zur Ablehnung der Historizität bleibt bestehen.
In zweieinhalb der vorgeschlagenen Kategorien ist die evangelikale Version nichts anderes als eine Fortsetzung der seit langem bestehenden evangelikalen Methodik bei der Erforschung der Evangelien. Schon lange vor dem Aufkommen der Redaktionskritik waren die Evangelikalen der Ansicht, dass die Verfasser nur einen Teil des ihnen zur Verfügung stehenden Materials auswählten, dass diese Auswahl aber als wirklich repräsentative und genaue Darstellung der historischen Ereignisse verstanden wurde. Matthäus, ein Begleiter Jesu, musste etwas auslassen. „Selektivität” ist keine neue Entdeckung der Redaktionskritik.
Dasselbe gilt für die „Anordnung”. Die Evangelikalen haben immer anerkannt, dass die Autoren die Beschreibungen manchmal in eine nicht chronologische Reihenfolge gebracht haben, wobei sie natürlich verstanden haben, dass nichts im Text eine chronologische Reihenfolge vorschreibt. In Matthäus 8-9 zum Beispiel unterstreicht die Gruppierung der Wunder Jesu seine Autorität. Die Wunder werden nicht in der Reihenfolge ihres Geschehens beschrieben.
In den Kategorien „Veränderung“ und „Kreativität“ sind die evangelikalen Redaktionskritiker jedoch zu radikalen Verfahren übergegangen. Geringfügige Veränderungen des Materials, die die stilistischen Vorlieben einzelner Autoren widerspiegeln, stehen im Einklang mit dem historischen evangelikalen Ansatz der biblischen Inspiration. Wenn diese Änderungen jedoch so umfangreich sind, dass sie die Substanz dessen, was bei einer bestimmten Gelegenheit getan oder gesagt wurde, revidieren, wird die seit langem bestehende evangelikale Verpflichtung zur historischen Genauigkeit der Heiligen Schrift zumindest untergraben, wahrscheinlich sogar verletzt. Wesentliche Veränderungen und Kreativität bewegen sich daher im Bereich einer radikalen Redaktionskritik, die den Evangelienschreibern die Aufzeichnung von Ungeschichtlichem zuschreibt, als wäre es Geschichte.
Die Evangelien müssen gemäß der Grammatik der griechischen Sprache und dem historischen Kontext ihrer Schauplätze interpretiert werden. Diese durch fragwürdige kritische Annahmen außer Kraft zu setzen, bedeutet, die historische Grundlage des Christentums ernsthaft in Frage zu stellen. Genau das hat die Redaktionskritik, auch die evangelikale, getan.
Es darf nicht zugelassen werden, dass sich Stimmungen einschleichen, die auf „Entdeckungen“ redaktioneller Akzente zurückgehen und die offensichtlicheren Akzente der Evangelien verdrängen. „Redaktionelle Akzente“ im Text sind in der Regel unbedeutende Details, die unverhältnismäßig aufgeblasen werden und eine weitreichende Bedeutung erhalten, die vom Autor nicht beabsichtigt war. Eine solche Aufblähung von Nebensächlichkeiten ist der Phantasie des Redakteurs und nicht dem Text geschuldet. Die Bedeutung größerer gedanklicher Einheiten im Text zu ignorieren und sich auf Kleinigkeiten zu versteifen, ist ein Beispiel für Exegese mit Tunnelblick. Den Befürwortern der Verbalinspiration wird oft vorgeworfen, dass sie sich zu sehr auf einzelne Worte des Textes konzentrieren und dabei die umfassendere Botschaft vernachlässigen, aber ihr Fehler ist winzig im Vergleich zu der Art und Weise, wie der redaktionelle Kritiker eine subtile, aber tiefe Bedeutung in den kleinsten Elementen des Textes auf Kosten der Gesamtbedeutung des größeren Abschnitts findet. Wenn eine dieser „redaktionellen Entdeckungen“ Fragen nach der Historizität der Evangelien aufwirft, ist die Bevorzugung der „Entdeckung“ gegenüber der offensichtlichen historischen Bedeutung durch den Ausleger äußerst subjektiv.
Es ist legitim, nach den theologischen Schwerpunkten der Evangelienschreiber zu suchen, aber dies muss geschehen, ohne die historische Genauigkeit der Aufzeichnungen in Frage zu stellen. Theologische Absicht und historische Genauigkeit sind miteinander vereinbar. Jeder Autor hat Teile der Betonung Jesu beibehalten, so dass die Kombination der Betonungen die Theologie Jesu selbst ergibt. Die Redaktionskritik ist ein Beispiel für einen Ansatz, der die Zuverlässigkeit der Evangelienberichte über die Worte und Taten Jesu in Frage stellt und als solcher mit einem uneingeschränkten Bekenntnis zur Autorität der Heiligen Schrift unvereinbar ist.
Dr. Robert L. Thomas
Dr. Stanley N. Gundry
Weiterführende Literatur
Bornkamm, Gunther. The New Testament: A Guide to Its Writings. Translated by Reginald H. Fuller and Ilse Fuller. Philadelphia: Fortress, 1973. Pp. 50-66.
Bornkamm, Gunther, Gerhard Barth, and Heinz Joachim Held. Tradition and Interpretation in Matthew. Translated by Percy Scott. Philadelphia: Fortress, 1963.
Conzelmann, Hans. The Theology of St. Luke. Translated by Geoffrey Buswell. New York: Harper, 1960.
Feine, Paul, and Johannes Behm. Introduction to the New Testament. Reedited by Werner Georg Kummel. Translated by A. J. Mattill, Jr. Nashville: Abingdon, 1966. Pp. 62-68, 75-84, 91-102.
France, R. T. “The Authenticity of the Sayings of Jesus.” In History, Criticism and Faith, edited by C. Brown, 101-43. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1976.
Guelich, Robert A. “The Gospels: Portraits of Jesus and His Ministry,” Journal of the Evangelical Theological Society 24 (1981): 117-25.
____. The Sermon on the Mount, a Foundation for Understanding. Waco, TX: Word, 1982.
Gundry, Robert H. Matthew, a Commentary on His Literary and Theological Art. Grand Rapids: Eerdmans, 1982.
Guthrie, Donald. New Testament Introduction. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1970. Pp. 214-19.
Hagner, Donald A. “Interpreting the Gospels: The Landscape and the Quest,” Journal of the Evangelical Theological Society 24 (1981): 23-27.
Harrison, Everett F. “Gemeindetheologie: The Bane of Gospel Criticism.” In Jesus of Nazareth: Saviour and Lord, edited by Carl F. H. Henry, 157-73. Grand Rapids: Eerdmans, 1966.
Hiebert, D. Edmond. An Introduction to the New Testament. The Gospels and Acts. Vol. 1. Chicago: Moody, 1975. Pp. 184-88.
Johnston, Wendell G., et al. “The Evangelical and Redaction Criticism in the Synoptic Gospels,” Talbot Review 1:2 (Summer 1985): 6-13.
Kantzer, Kenneth S. “Redaction Criticism: Is It Worth the Risk?” Christianity Today 29:15 (Oct. 18, 1985): 1-l-12-l.
Lane, William L. Commentary on the Gospel of Mark. NIC. Grand Rapids: Eerd-mans, 1974.
Marshall, I. Howard. Luke: Historian and Theologian. Grand Rapids: Zondervan, 1970.
____. Commentary on Luke. NIGTC. Grand Rapids: Eerdmans, 1978.
Marxsen, Willi. Introduction to the New Testament. Translated by G. Buswell. Philadelphia: Fortress, 1964. Pp. 136-42, 147-52, 155-61.
____. Mark the Evangelist. Translated by James Boyce, Donald Juel, and William Poehlmann with Roy A. Harrisville. Nashville: Abingdon, 1969.
Perrin, Norman. What is Redaction Criticism? Philadelphia: Fortress, 1969. Stein,
R. H. “The ‘Criteria’ for Authenticity,” Gospel Perspectives. 2 vols., edited by R. T. France and D. Wenham. Sheffield, England: JSOT, 1980-1981. Pp. 1:225-63.
Silva, Moises. “Ned B. Stonehouse and Redaction Criticism,” Westminster Theological Journal 40 (1977-1978): 77-88, 281-303.
Thomas, Robert L. “The Hermeneutics of Evangelical Redaction Criticism,” Journal of the Evangelical Theological Society 29 (1986), 447-59.
____. “The Rich Young Man in Matthew,” Grace Theological Journal 3 (1982): 235-60.
____. “Another View,” Christianity Today 29:15 (Oct. 18, 1985): 8-I.