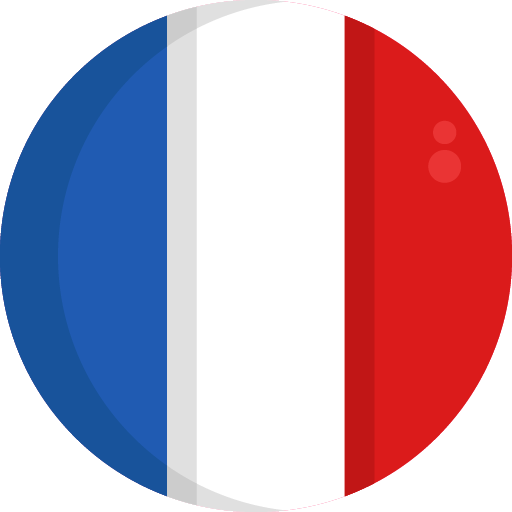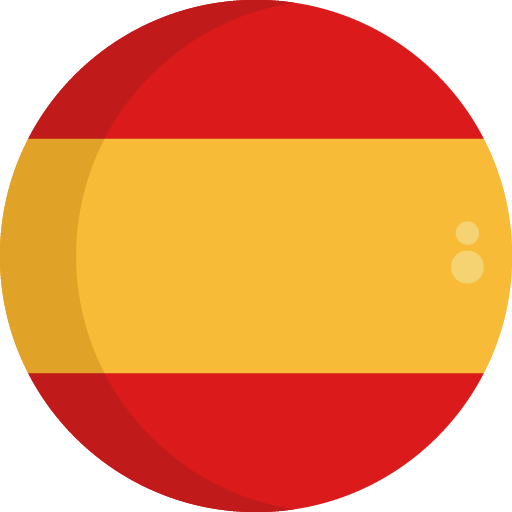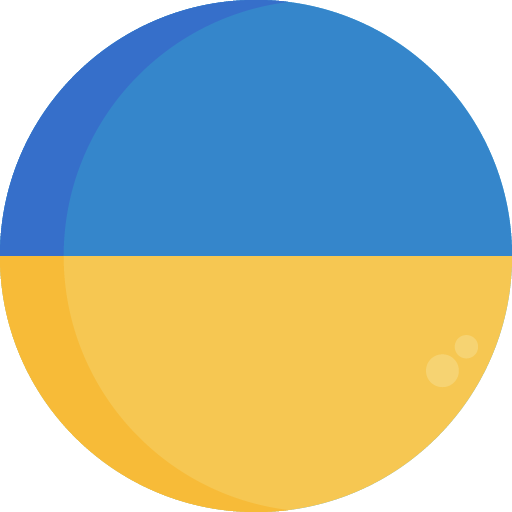Essay #09
Die Genealogien in Matthäus und Lukas
Sowohl Matthäus als auch Lukas geben eine Genealogie der Abstammung von Jesus. Vergleicht man diese, so fallen sofort Unterschiede und Schwierigkeiten auf. Der augenfälligste Unterschied besteht darin, dass die Liste bei Matthäus mit Abraham beginnt und bis zu Jesus vorwärtsgeht, während die Liste bei Lukas mit Jesus beginnt und bis zu Adam zurückgeht. Dies stellt an sich keine Schwierigkeit dar, aber wenn man eine der Listen in umgekehrter Reihenfolge aufstellt, um den Vergleich zu erleichtern, sieht die Sache ganz anders aus. Natürlich gibt nur Lukas die Generationen von Adam bis Abraham an, und die Listen der Stammväter zwischen Abraham und David bei Matthäus und Lukas sind fast identisch. Problematisch wird es erst, wenn wir die beiden Versionen der Nachkommenschaft von David bis Jesus vergleichen:
|
Matthäus’ Liste (Auszug) |
Lukas’ Liste (Auszug in umgekehrter Reihenfolge) |
|
David Salomo Rehabeam Abija Asa Josaphat Joram Ussiah Jotham Ahas Hiskia Manasse Amon Josia Jekonja Schealtiel Serubbabel Abihud Eljakim Azor Zadok Achim Elihud Eleasar Matthan Jakob Joseph (Ehemann von Maria) Jesus |
David Nathan Mattatha Menna Melea Eliakim Jonan Joseph Juda Simeon Levi Matthat Jorim Elieser Joses Er Elmodam Kosam Addi Melchi Neri Schealtiel Serubbabel Resa Johanna Juda Joseph Semei Mattathias Maath Naggai Esli Nahum Amos Mattathias Joseph Janna Melchi Levi Matthat Eli Joseph Jesus (“wie man meinte, ein Sohn Josephs“) |
Für Studierende, die an einer Harmonisierung der Evangelien interessiert sind, wirft der obige Vergleich zwei Probleme auf: die unterschiedliche Anzahl der Generationen und die Unähnlichkeit der Namen. Wie kann man die beiden Genealogien harmonisieren, ohne ihre historische Integrität zu opfern?
In neueren kritischen Untersuchungen werden die bisherigen Harmonisierungsversuche meist als vergebliche Mühe bezeichnet. Sowohl H. C. Waetjen als auch M. D. Johnson bezeichnen die bisherigen Bemühungen um eine vollständige historische Authentizität als nicht überzeugend, mühsam und neben der Sache liegend. In jedem Fall, so wird argumentiert, wird die Historizität die existentielle Reaktion des Lesers oder sein Verständnis der neutestamentlichen Theologie nicht wesentlich beeinflussen. Vielmehr muss jede Genealogie individuell und theologisch in Bezug auf das Evangelium, in dem sie erscheint, und auf den Gedanken des Evangelisten, den sie ausdrücken soll, verstanden werden. Der Inhalt und die Struktur einer jeden Genealogie sind angeblich willkürlich, um dem Zweck des Evangelisten zu entsprechen. Was diese spezifischen Zwecke waren, muss hier nicht untersucht werden, da die Analysen von Gelehrten wie Waetjen und Johnson den Annahmen und der Methodologie eines Großteils der neueren neutestamentlichen kritischen Gelehrsamkeit folgen. Ihre Analysen sind nicht besser als ihre Annahmen und ihre Methodologie. Und die grundsätzliche Frage nach der historischen Zuverlässigkeit von Genealogien kann nicht leichtfertig umgangen werden. Wir wenden uns daher den Problemen der Harmonisierung der beiden Abstammungslisten von Jesus zu.
Das erste Problem, die unterschiedliche Anzahl der Generationen, ist am einfachsten zu lösen. Es stimmt zwar, dass Matthäus zwischen David und Jesus sechsundzwanzig Stammväter aufzählt, während es bei Lukas vierzig sind, aber zwei Faktoren müssen berücksichtigt werden. Erstens ist es nicht ungewöhnlich, dass sich die Generationen in einer Linie schneller vermehren als in einer anderen. Zweitens, und das ist noch wichtiger, kann Sohn im jüdischen Denken Enkel oder allgemeiner Nachkomme bedeuten (wie „Jesus Christus, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams“, Mt 1,1). In ähnlicher Weise bedeutet zeugte (in der Elberfelder Version, Matthäus 1,2-16, nach dem Muster „X war der Vater von Y“) nicht notwendigerweise „war der tatsächliche (d.h. unmittelbare) Vater von“, sondern kann auch einfach auf eine tatsächliche Abstammung hinweisen. Die Tatsache, dass Matthäus seine Liste in drei Gruppen von vierzehn Generationen einteilt, deutet darauf hin, dass dies eine einfache, zusammenfassende Anordnung war, bei der einige Generationen ausgelassen worden sein könnten. Tatsächlich lässt sich zeigen, dass die Liste des Matthäus Auslassungen enthält (vgl. 2 Kön 8,24; 1 Chron. 3:11; 2 Chron. 22,1.11; 24,27; 2. Könige 23,34; 24,6). Das Auslassen von Generationen in biblischen Genealogien ist kein Einzelfall. Es ist bekannt, dass Juden dies gerne taten. Der Zweck einer Genealogie bestand nicht darin, über jede Generation Rechenschaft abzulegen, sondern die Tatsache einer unzweifelhaften Erbfolge festzustellen, die insbesondere die prominentesten Vorfahren einschloss.
Das zweite Problem ist schwieriger zu lösen. In den beiden Nachfolgelisten sind alle Namen zwischen David und Joseph verschieden, mit Ausnahme von Schealtiel und Serubbabel (in der Liste durch gestrichelte Linien verbunden). Wie ist das zu erklären? Einige Exegeten verzweifeln unnötigerweise an einer angemessenen Lösung oder behaupten sogar, die Listen seien fehlerhaft. Andere sehen in ihnen ein redaktionelles Mittel, mit dem die Schreiber ihre theologischen Ziele zu erreichen suchten (siehe Essay#05 – Redaktionskritik). Unter allen Versuchen, die Genealogien miteinander in Einklang zu bringen, verdienen jedoch vier Vorschläge Beachtung.
- Julius Africanus (gest. 240 n. Chr.) schlug vor, dass Matthäus die Genealogie Josephs über seinen physischen Vater Jakob wiedergibt, während Lukas die Genealogie Josephs über seinen rechtlichen Vater Eli wiedergibt. Demnach starb Eli kinderlos. Sein Halbbruder Jakob, der dieselbe Mutter, aber einen anderen Vater hatte, heiratete Elis Witwe und zeugte mit ihr Joseph. Diese so genannte Leviratsehe bedeutete, dass Joseph physisch der Sohn Jakobs und rechtlich der Sohn Elis war. Jakob stammte über Davids Sohn Salomo von David ab und Eli über Davids Sohn Nathan von David. Somit hatte Joseph sowohl durch seine rechtliche als auch durch seine leibliche Abstammung einen rechtmäßigen Anspruch auf den davidischen Thron, was auch für seinen rechtlichen (aber nicht leiblichen) Sohn Jesus gilt. Matthäus gibt die leibliche, Lukas die rechtliche Abstammung Josephs an.
- In seinem klassischen Werk Die Jungfrauengeburt Christi vertrat J. Gresham Machen die Ansicht, dass Matthäus die rechtliche Abstammung Josephs angibt, während Lukas hauptsächlich die physische Abstammung angibt (er erlaubt Levirat oder die Übertragung der Abstammung auf eine Seitenlinie in der physischen Linie Josephs). Obwohl die physische und die rechtliche Linie vertauscht sind, geht es immer noch darum, Josephs rechtmäßigen Anspruch auf den davidischen Thron zu begründen. Nach dieser Auffassung scheiterte die rechtliche Linie Salomos an Jekonja (Jer. 22,30). Als die königliche Linie über Salomo erlosch, erbte das lebende Mitglied der Seitenlinie Nathans (Schealtiel, Matthäus 1,12, und Lukas 3,27) den Thronanspruch. Nach Machen verfolgt Matthäus also die rechtliche Thronfolge von David über Salomo zu Jekonja, wobei die Thronfolge an dieser Stelle auf eine Seitenlinie übergeht. Lukas verfolgt die physische Abstammung (mit der Möglichkeit von Sprüngen in eine Seitenlinie oder Levirat) bis zu David über Nathan. Matthäus beginnt mit der Frage: Wer ist der Thronfolger Davids? Lukas beginnt mit der Frage: Wer ist der Vater Josephs?
Eine große Zahl von Gelehrten hat sich für eine Form dieser Ansicht ausgesprochen, darunter A. Hervey, Theodor Zahn, Vincent Taylor und Brooke F. Westcott. - Eine dritte Ansicht besagt, dass der scheinbare Konflikt zwischen den beiden Josephs-Genealogien darauf zurückzuführen ist, dass Lukas irrtümlich annimmt, die Josephs-Genealogie wiedergeben zu wollen. Stattdessen sollte es als die Genealogie Marias verstanden werden. Josefs Name steht stellvertretend für den Namen Marias, weil er durch die Heirat mit Eli (Marias Vater) dessen Sohn bzw. Erbe wurde. Nach dieser Auffassung starb Eli ohne Söhne, und Maria wurde seine Erbin (Num 27,1-11; 36,1-12). Die erste dieser Stellen scheint die Bewahrung des Namens des Mannes vorzusehen, der mit Töchtern, aber ohne Söhne stirbt. Im Fall von Eli und seiner Tochter Maria könnte dies dadurch erreicht worden sein, dass Joseph mit der Familie Marias identifiziert wurde. Josef würde in die Genealogie der Familie aufgenommen, obwohl die Genealogie eigentlich die von Maria ist. So unterscheiden sich die Genealogien von Matthäus und Lukas von denen Davids, weil Matthäus die davidische Abstammung Josephs und Lukas die davidische Abstammung Marias (mit dem Namen Josephs) nachzeichnet.
Jeder der drei bisher diskutierten Vorschläge würde den offensichtlichen Konflikt zwischen den Genealogien bei Matthäus und Lukas auflösen. Jeder von ihnen scheint auch im Bereich des Möglichen zu liegen. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass alle drei auf Vermutungen beruhen, die zwar möglich, aber keineswegs sicher sind. Bei den ersten beiden Ansichten muss man sich auf Leviratsehen oder Seitenlinien berufen, um die Schwierigkeiten zu lösen. Die dritte Ansicht beruht auf der Annahme, dass Joseph den Platz Marias in der Genealogie einnimmt. Darüber hinaus muss die erste Ansicht erklären, warum Lukas und nicht Matthäus an der rechtlichen Abstammung Josephs interessiert ist. Sowohl die erste als auch die zweite Sichtweise müssen erklären, warum Lukas angesichts seines offensichtlichen Interesses an Maria und seiner engen Beziehung zu ihr überhaupt auf die Genealogie Josephs eingeht. Warum sollte Lukas, der sich für Jesu Menschsein, Geburt und Kindheit interessierte, die Genealogie des Mannes aufführen, der zwar der rechtliche, aber nicht der leibliche Vater Jesu war? Diese Fragen sind nicht unbeantwortbar, aber sie öffnen das Feld für eine Sichtweise, die weniger auf Vermutungen angewiesen ist und diese Fragen nicht aufwirft. Es gibt eine solche Sichtweise:
- Wie der dritte Lösungsvorschlag versteht diese vierte Ansicht den Stammbaum bei Lukas tatsächlich als den Stammbaum Marias, aber aus anderen Gründen. Hier wird Eli als Stammvater Marias verstanden, nicht als Stammvater Josephs. Josef gehört eigentlich nicht zum Stammbaum und wird nur in Klammern oder einem Nebensatz erwähnt. Lukas 3,23 wäre dann in deutscher Grammatik geschrieben: „Jesus … war der Sohn (wie man meinte, von Joseph) des Eli“. (Die Elberfelder Übersetzung vertauscht die Worte „der Sohn“ und “wie man meinte“) Die Unterstützung für diese Ansicht ist sehr überzeugend.
-
- Wie der dritte Lösungsvorschlag versteht diese vierte Ansicht den Stammbaum bei Lukas tatsächlich als den Stammbaum Marias, aber aus anderen Gründen. Hier wird Eli als Stammvater Marias verstanden, nicht als Stammvater Josephs. Josef gehört eigentlich nicht zum Stammbaum und wird nur in Klammern oder einem Nebensatz erwähnt. Lukas 3,23 wäre dann in deutscher Grammatik geschrieben: „Jesus … war der Sohn (wie man meinte, von Joseph) des Eli“. (Die Elberfelder Übersetzung vertauscht die Worte „der Sohn“ und “wie man meinte“) Die Unterstützung für diese Ansicht ist sehr überzeugend.
- Es ist grammatikalisch gerechtfertigt, den Satzteil „wie man meinte, von Joseph“ in Klammern zu setzen und ihn damit aus der Genealogie herauszunehmen. Der griechisches Originaltext enthält keine Satzzeichen. Ausserdem steht im griechischen Text der Name Joseph ohne den vorangestellten griechischen bestimmten Artikel; jeder andere Name in der Reihe hat diesen Artikel. Auf diese Weise wird gezeigt, dass der Name Josef nicht wirklich zur Genealogie gehört. Jesus wurde nur als sein Sohn angesehen. Dies würde Jesus zum Sohn (d.h. Enkel oder Nachkomme) von Eli, dem Stammvater Marias, machen und stimmt mit dem lukanischen Bericht über die Empfängnis von Jesus überein, der deutlich macht, dass Josef nicht sein leiblicher Vater war (Lk 1,26-38).
- Diese Ansicht nimmt die natürlichste Bedeutung von zeugte an. Mit anderen Worten, zeugte bezieht sich auf die tatsächliche physische Abstammung und nicht auf Sprünge zu Seitenlinien.
- Das Interesse des Matthäus an der Beziehung Jesu zum Alten Testament und zum messianischen Reich macht es angemessen, dass er die tatsächliche Abstammung Josephs von David durch Salomo angibt, eine Abstammung, die auch die rechtliche Abstammung Jesu ist und ihm somit einen Rechtsanspruch auf den davidischen Thron verleiht.
- Da Lukas das Menschsein von Jesus, seine Solidarität mit dem Menschengeschlecht und die Universalität des Heils betont, ist es nur angemessen, dass Lukas seine Menschlichkeit zeigt, indem er seine menschliche Abstammung von seiner menschlichen Mutter Maria aufzeigt. Sein Stammbaum reicht dann bis zu Adam zurück.
- Auf den Einwand, dass Marias Name in der lukanischen Version nicht vorkommt, braucht man nur zu antworten, dass Frauen in den jüdischen Genealogien nur selten vorkamen; obwohl Lukas ihre Abstammung angibt, entspricht er dem Brauch, sie nicht namentlich zu erwähnen. Dem Einwand, dass die Juden nie die Genealogie von Frauen auflisteten, ist zu entgegnen, dass es sich hier um einen Einzelfall handelt; Lukas spricht von einer Jungfrauengeburt. Wie sonst sollte die leibliche Abstammung von jemandem, der keinen menschlichen Vater hatte, nachvollziehbar sein? Darüber hinaus hat Lukas bereits eine kreative Abweichung von den üblichen genealogischen Listen gezeigt, indem er mit Jesus beginnt und die Liste der Vorfahren zurückgeht, anstatt an einem Punkt in der Vergangenheit zu beginnen und zu Jesus vorwärts zu gehen.
- Mit dieser Sichtweise lassen sich die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Jekonja (Mt 1,11), dem Vorfahren Josephs und Nachkommen Davids durch Salomo, leicht lösen. In 2. Sam. 7,12-17 wird die Fortsetzung des davidischen Reiches durch Salomo (V. 12-13) bedingungslos verheißen. Jekonja war später der königliche Repräsentant dieses Geschlechts, dem die Ewigkeit verheißen war. Doch wegen seiner schweren Sünde (2. Chronik 24,8-9) sollte Jekonja als kinderlos verzeichnet werden und kein Nachkomme von ihm auf dem davidischen Thron sitzen (Jer. 22,30). Das ist ein Dilemma. Der Thron Salomos war bereits bedingungslos für die Ewigkeit verheißen. Aber Jekonja wird keine leiblichen Nachkommen haben, die auf diesem Thron sitzen können. Wie können sowohl die göttliche Verheißung als auch der Fluch in Erfüllung gehen?
Zunächst ist festzuhalten, dass Jeremias Bericht weder besagt, dass Jekonja keine Nachkommen haben würde, noch dass Jekonjas Linie durch seine Sünde ihren Thronanspruch verloren hätte. Der Thronanspruch bleibt bei der Linie Jekonjas, und Matthäus zeichnet diese Linie bis zu Joseph nach. In 1,16 bewahrt Matthäus die jungfräuliche Geburt Jesu und macht zugleich deutlich, dass Jesus nicht unter dem Fluch Jekonjas steht. Er bricht mit dem Muster und vermeidet sorgfältig zu sagen, dass Joseph (ein Nachkomme Jekonjas) Jesus gezeugt hat. Stattdessen spricht er von „Joseph, dem Mann der Maria, von der Jesus geboren wurde“. Im griechischen Text steht „von der“ im weiblichen Singular und kann sich nur auf Maria beziehen, die nicht von Jekonja abstammte. Was die menschliche Abstammung betrifft, so wurde Jesus allein von Maria geboren, obwohl Josef sein rechtlicher Vater war. Als rechtlicher Vater von Jesus ging der Rechtsanspruch Josephs auf Jesus über. Da Jesus aber nicht der Nachkomme Jekonjas war, obwohl er durch Maria, die Nachfahrin Nathans, tatsächlich davidischer Abstammung war, entging er dem Fluch, der in Jeremia 22,30 über die Nachkommen Jekonjas ausgesprochen wurde. Damit ist das Problem gelöst.
Wir haben also zwei verschiedene Genealogien zweier Personen. Wahrscheinlich sind sogar Schealtiel und Serubbabel bei Matthäus und Lukas verschiedene Personen. Diese vierte Sichtweise hängt nicht von Vermutungen ab, sondern stützt sich auf Beweise in den Texten selbst, entspricht den Absichten der Evangelisten und löst das Problem des Jekonja auf einfache Weise. L. M. Sweet hat über diese Sicht treffend geschrieben: „In seiner Einfachheit und seiner gelungenen Anpassung an die komplexe Gesamtsituation ist es geradezu eine Empfehlung“.
Obwohl es sich hier nicht um ein eigentliches Harmonieproblem handelt, muss an dieser Stelle auf eine andere Schwierigkeit von geringerer Bedeutung hingewiesen werden, die sich in Matthäus’ Darstellung des Stammbaums Josephs findet. In 1,17 teilt Matthäus die Generationen von Abraham bis Christus in drei Gruppen von vierzehn Generationen ein: von Abraham bis David, von David bis zur Deportation nach Babylon und von der Deportation bis Christus. Dies war vermutlich eine Gedächtnisstütze für Matthäus und es bedeutet nicht, dass er jeden Stammvater erwähnt hat. Mindestens fünf Namen fehlen: Ahasja, Joasch, Amazja, Jojakim und Eljakim. Wie bereits erwähnt, war dieses Vorgehen nicht ungewöhnlich und stellt kein wirkliches Problem dar.
Bei drei Gruppen mit vierzehn Generationen erwartet man zweiundvierzig verschiedene Namen. Es sind aber nur 41. Auch wenn eine Gruppe nur dreizehn verschiedene Namen hat, ist das Problem offensichtlich. Matthäus spricht nicht von zweiundvierzig verschiedenen Namen, sondern von drei Gruppen von vierzehn Generationen, die er für sich selbst aufteilt. Der Name David schließt die erste Gruppe ab und steht in der zweiten an erster Stelle (vgl. 1,17). Mit anderen Worten: David wird zweimal gezählt und erhält dadurch eine besondere Bedeutung in der Genealogie, die den davidischen Thronanspruch Jesu über seinen rechtlichen Vater Josef aufzeigt. Ein weiteres Mittel, David in den Mittelpunkt zu rücken, ist der Titel, der ihm in Matthäus 1,6 verliehen wird. Er wird König David genannt und ist die einzige Person in der Genealogie, der ein Titel verliehen wird. Möglicherweise wird die davidische Betonung durch die Zahl 14 noch verstärkt. Die Summe der Zahlenwerte der hebräischen Buchstaben im Namen David ist 14, was dem modernen Leser allzu subtil erscheinen mag, im antiken semitischen Denken aber nicht unbedingt so war. Allerdings ist der Zahlenwert des Namens David für die Lösung des Problems nicht notwendig. Auch hier zeigt sich, dass die angeblichen Diskrepanzen zwischen und in den genealogischen Listen von Matthäus und Lukas mehr Schein als Sein sind. Es gibt vernünftige Lösungen für die Probleme, die sogar mehr Licht auf den Text werfen.
Dr. Robert L. Thomas
Dr. Stanley N. Gundry
Weiterführende Literatur
Johnson, Marshall D. The Purpose of the Biblical Genealogies: With Special Reference to the Setting of the Genealogies of Jesus. Cambridge: Cambridge University Press, 1969. Pp. 139-256.
Machen, J. Gresham. The Virgin Birth of Christ. New York: Harper, 1930. The international Standard Bible Encyclopedia, s.v. “The Genealogy of Jesus Christ,” by L. M. Sweet.
Waetjen, Herman C. “The Genealogy as the Key to the Gospel according to Matthew,” Journal of Biblical Literature 95 (1976): 205-30.