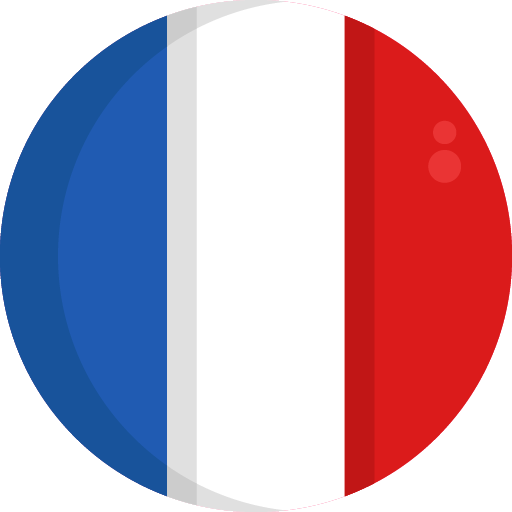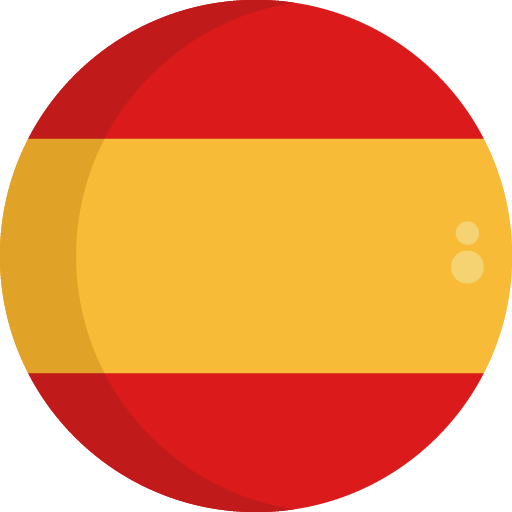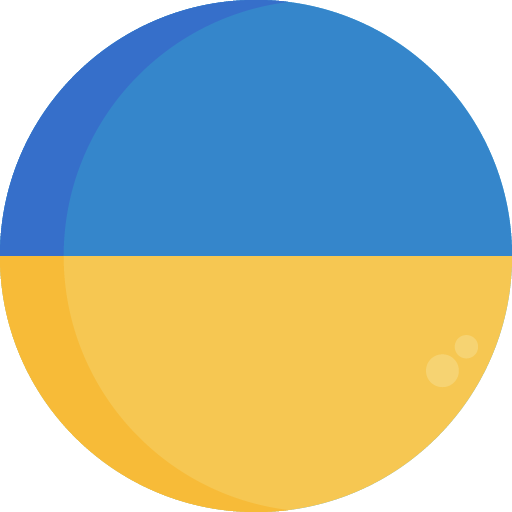Essay #01
Ist eine Harmonisierung der Evangelien legitim?
Bis ins 19. und sogar bis ins 20. Jahrhundert hinein war es eine Tatsache, dass die Herstellung einer Evangelienharmonie eine legitime Aufgabe war. Seit dem Aufkommen der modernen Kritik ist die Harmonisierung jedoch keine allgemein anerkannte Methode mehr. Eine wachsende Zahl von Menschen fragt sich, ob die Erforschung des Lebens Jesu – mit anderen Worten die Erstellung einer Harmonie der biblischen Berichte über sein Leben – in dieser Form durchgeführt werden kann und soll.
Der Widerstand gegen ein solches Projekt folgt verschiedenen Ansätzen:
- Ein Ansatz besteht darin, zu betonen, dass die Evangelien nicht als Geschichten, sondern eben als Evangelien geschrieben wurden. Mit einer solchen Grundannahme über die Intention der Schreiber müsste man davon ausgehen, dass aus einer Biographie Jesu wenig zu gewinnen wäre. Dieser Einwand ist jedoch logisch schwach. Eine evangelistische Absicht schließt historische Genauigkeit nicht von vornherein aus. Im Gegenteil, ein kluger Evangelist wird eine möglichst genaue Darstellung anstreben, um die Sache, die er verkündet, nicht durch abwegige Behauptungen zu untergraben (Lukas 1,3-4). Ein weiteres Grundprinzip des Christentums ist die Ehrlichkeit. Da es die Absicht der Evangelisten war, auf der Grundlage von Nachforschungen möglichst genaue Berichte zu verfassen (Lukas 1,3-4), ist es unwahrscheinlich, dass gerade diejenigen, die über dieses Grundprinzip geschrieben haben, in denselben Büchern historische Wahrheiten verfälschen.
- Ein weiterer Versuch, die Evangelienharmonisierung abzuwerten, kommt von einigen, die bezweifeln, dass es einen historischen Jesus überhaupt gegeben hat. Für diese Extremisten, deren Zahl eher gering ist, ist Jesus nicht mehr als eine mythologische Gestalt, wie man sie in den Naturmythen und mystischen Religionen der griechisch-römischen Welt findet. Die Tatsache, dass Jesus Christus eine historische Person war, wird durch eine erstaunliche Anzahl historischer Dokumente bestätigt, die von jüdischen, römischen und christlichen Schriftstellern verfasst wurden. Darüber hinaus ist die Existenz der christlichen Kirche nur auf der Grundlage seiner historischen Persönlichkeit erklärbar.
- Andere versuchen, die Unergiebigkeit der Harmonien zu beweisen, indem sie behaupten, dass die Überlieferungen der frühchristlichen Kirchen nur lose berücksichtigt werden. Die Kirche habe sich einzelne Berichte über die Person Jesu herausgesucht und diese erweitert, um die Aussagen und Taten Jesu in ihrem Sinne darzustellen. Die Methode, mit der zwischen Tatsachen und Erweiterung unterschieden werden soll, wird Formkritik genannt (siehe Essay #04 – Formkritik). Bei einer solchen Kritik des historischen Wertes der Evangelien treten verschiedene Schwierigkeiten auf. Eine davon ist die Grundannahme der Kritiker, dass diejenigen, die den stärksten Grund hatten, sich für die historischen Fakten des Lebens Jesu zu interessieren, wenig oder kein Interesse daran hatten, diese Fakten zu überprüfen oder weiterzugeben. Die Formkritik nimmt auch an, dass Augenzeugen des Lebens Jesu stillschweigend zusahen, wie falsche Berichte über Jesus als Wahrheiten ausgegeben wurden. So etwas ist schlicht undenkbar.
- Eine neuere Theorie, die Redaktionskritik, hat ebenfalls Gründe gegen die wörtliche Akzeptanz der Evangelien angeführt (siehe Essay #05 – Redaktionskritik). Diese Disziplin konzentriert sich besonders auf die Schreiber der Evangelien und ihre spezifischen theologischen Absichten. Die Redaktoren hätten die überlieferten Überlieferungen so aufgenommen und gestaltet, dass sie ihr eigenes Verständnis und das der Kirche vom Kerygma (Verkündigung/das gepredigte Wort/das Evangelium“) widerspiegelten. Dadurch, so die redaktionelle Kritik, hätten sie den historischen Jesus und seine Lehre noch mehr verdunkelt als die Generationen vor ihnen. Es ist davon auszugehen, dass jeder einzelne Evangelist ein bestimmtes Ziel verfolgte, aber es ist nicht erwiesen, dass er deshalb die vorhandenen Tatsachen veränderte, um sein Ziel zu erreichen. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes waren aufrichtige Männer, die über ein System der Wahrheit um den geschrieben haben, der selbst die Wahrheit ist. Ihnen auch nur im Entferntesten eine Fülle von Lügen zuzuschreiben, und seien es auch „fromme Lügen“, wie es die redaktionelle Kritik tut, bedeutet, die Wahrheit selbst in Frage zu stellen. Für diesen Einwand gegen die Harmonisierung der Evangelien sind bisher keine stichhaltigen Gründe vorgebracht worden.
- Die Position einiger Evangelikaler, die sich für die redaktionskritische Methode aussprechen, ist dem Einwand unter Punkt 4 sehr ähnlich. Sie sind nicht damit einverstanden, dass die Evangelisten die verfügbaren Fakten angepasst haben. Aber sie halten daran fest, dass die Evangelienberichte und andere damit zusammenhängende Merkmale von zweifelhaftem Wert sind, wenn es darum geht, das Leben Christi chronologisch einzuordnen. Diese Bibelwissenschaftler bezeichnen die Evangelien nicht als unhistorisch, sondern nehmen eine agnostische Haltung ein, indem sie Zweifel an der Möglichkeit einer Harmonisierung der Evangelien äußern. Damit nehmen sie eine Mittelposition gegenüber der historischen Genauigkeit der Evangelien ein und müssen sich ständig fragen, wie sie ihre Ansichten mit der hohen Autorität der Bibel in Einklang bringen können (Siehe Abschnitt “Evangelikaler Gebrauch der Redaktionskritik” in Essay #005 – Redaktionskritik). Wenn die Evangelien historische Dokumente sind, dann müssen sie verbindende Teile und chronologische Hinweise enthalten, was auch diese Gegner nicht ausschließen können.
- Ein weiteres, für manche unüberwindbares Problem ist die enorme Schwierigkeit, parallele Erzählungen zu harmonisieren (siehe Essay #07 – Probleme und Grundsätze der Harmonisierung). Einige Teilbereiche sind so kompliziert, dass die einzige Lösung darin besteht, davon auszugehen, dass es keine Lösung gibt. Diese Auffassung ist oft mit einer geringeren Wertschätzung der biblischen Inspiration verbunden, als sie die orthodoxe Christenheit traditionell verstanden hat. Leider zeigt sich hier und da die Bereitschaft, denjenigen Recht zu geben, die aktiv die biblische Fehlbarkeit vertreten. Das ist aber nicht nötig. Wer bereit ist, die Bibel so zu sehen, wie sie sich selbst sieht, nämlich als irrtumslos, wird in der Regel für die meisten Harmonisierungsprobleme keine hinreichende Begründung finden. Die verbleibenden Probleme können vernünftig erklärt werden, obwohl zugegeben werden muss, dass befriedigende Antworten nur durch weitere Entdeckungen gegeben werden können.
- Andere, die einen eher konservativen Zugang zu den Evangelien haben, lehnen Harmonisierungsversuche ab, weil sie den biblischen Text nicht „verpfuschen“ wollen. Sie sagen, wenn Gott gewollt hätte, dass wir eine Harmonisierung des Lebens Christi erhalten, dann hätte er uns ein Evangelium anstelle von vier Evangelien gegeben. Dem ist zu entgegnen, dass eine Evangelienharmonie, zumal eine solche, in der die Texte der Evangelien in ihrer Gesamtheit in einer eigenen Spalte erhalten bleiben, nicht den Versuch darstellt, die jeweiligen Beiträge der einzelnen Evangelien zu zerstören. Die grammatikalische und historische Auslegung jedes Evangeliums als Einheit muss das grundlegende Element für das Verständnis der Offenbarung Gottes in Jesus Christus bleiben. Zugleich aber kann für das grammatikalisch-historische Verständnis viel gelernt werden, wenn durch den systematischen Vergleich das Licht entdeckt wird, das die Evangelien aufeinander werfen. Eine Harmonisierung ist kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung zur Exegese der einzelnen Bücher.
- Ein letzter Einwand kann noch vorgebracht werden. Es wird behauptet, dass die Verfasser der Evangelien, insbesondere Lukas, in historischen Fragen nicht mit den weltlichen Quellen übereinstimmen und dass es daher töricht wäre, die vier Evangelien so zusammenzufassen, als wären sie historische Dokumente. Obwohl solche Unstimmigkeiten angedeutet wurden, müssten sie noch bestätigt werden. Tatsächlich haben archäologische Funde und historische Forschungen immer wieder die Genauigkeit der biblischen Berichte bestätigt. Es gibt also keinen überzeugenden Grund zu glauben, dass die Evangelien falsch sind, weil sie gegen nichtbiblische Beweise verstoßen. Es ist sogar möglich, dass wir uns manchmal mit Beweisen aus nichtbiblischen Quellen oder mit unserer Interpretation dieser Beweise irren.
Auf der anderen Seite gibt es gute Gründe dafür, die Evangelien so zu ordnen, dass sowohl ihre Parallelen als auch ihre jeweiligen Details zur Geltung kommen:
- Erstens gibt eine Harmonisierung diesen historischen Dokumenten die Anerkennung, die sie verdienen. Die in den Evangelien genannten Orte haben eine geographische Bedeutung. Datumsangaben und chronologische Bemerkungen sind Elemente, die ebenfalls historische Bedeutung haben (siehe Essay #10 – Der Tag und das Jahr der Kreuzigung von Jesus, und Essay #11 – Die Chronologie von Jesus’ Leben). Die in den Evangelien erwähnten Personen haben tatsächlich gelebt. Die Harmonie klärt die Beziehungen zwischen diesen Orten, Zeiten und Personen, was zu einem besseren Verständnis der einzelnen Schriften beiträgt.
- Die Harmonie macht auch die historische Grundlage des Christentums deutlich. Ohne eine solche faktische Grundlage wäre das Christentum nur eine weitere Weltreligion, etwas, das durch menschliche Phantasie zusammengesetzt wurde. Leider ist es heute ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Worte und Taten Jesu nicht relevant seien, sondern dass es vielmehr darum gehe, dass das Christentum den Bedürfnissen der Menschen begegnet. Die Worte und Taten Jesu sind jedoch relevant. Es ist unerlässlich, dass das Christentum einen historischen Jesus hat, wie er in den vier Evangelien beschrieben wird. Es ist unerlässlich, dass das Christentum auf dem Fundament seiner Auferstehung von den Toten aufbaut. Ohne historisches Fundament wäre das Christentum nur ein weiterer Schwindel. Eine Evangelienharmonie hilft zu zeigen, wie solide dieses historische Fundament des Christentums ist.
- Darüber hinaus fördert die Harmonie der Evangelien unser Wissen über den historischen Jesus. Wir gewinnen viele zusätzliche Einsichten, wenn wir jedem Evangelium erlauben, die Berichte der anderen zu ergänzen. Das Ergebnis ist ein umfassenderer Bericht über das Leben unseres Herrn.
- Schließlich sollte die heutige Kirche zur Kenntnis nehmen, dass der Leib Christi seit Anbeginn seiner Existenz Harmonien als förderlich für sein Wachstum anerkannt hat (siehe Essay #02 – Die Geschichte der Harmonisierung). Auch wenn sich das Wesen dieser Harmonien unterschieden hat, ist das Prinzip ihrer Notwendigkeit das gleiche geblieben. Die Ersetzung der Harmonien durch Synopsen in den letzten Jahren ist zweifellos auf die Zunahme der oben genannten Einwände zurückzuführen. Die Kirche kann es sich jedoch nicht leisten, von diesem Weg des Wachstums abzuweichen, nur weil einige die Gültigkeit der Harmonie zu Unrecht in Frage gestellt haben. Im Gegenteil, die Kirche hat Grund, sich über die Möglichkeit zu freuen, Jesus Christus besser kennen zu lernen, da die historische Forschung unser Wissen über die Zeit, in der er gelebt hat, immer mehr erweitert.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Einwände gegen die Methode der Evangelienharmonisierung nicht sehr überzeugend sind. Jedes Argument scheint auf schlecht begründeten Annahmen über Jesus, die Evangelien oder die Ziele der Harmonisierung zu beruhen. Auf der anderen Seite gibt es gute Gründe dafür, die Evangelien in Beziehung zueinander zu studieren. Man kann sogar sagen, dass Evangelienharmonien nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar notwendig sind, um zu einem ganzheitlichen Verständnis der Person und des Wirkens Christi zu gelangen.
Dr. Robert L. Thomas
Dr. Stanley N. Gundry
Weiterführende Literatur
Guthrie, Donald. A Shorter Life of Christ. Grand Rapids: Zondervan, 1970.
Harrison, Everett F. A Short Life of Christ. Grand Rapids: Eerdmans, 1968.