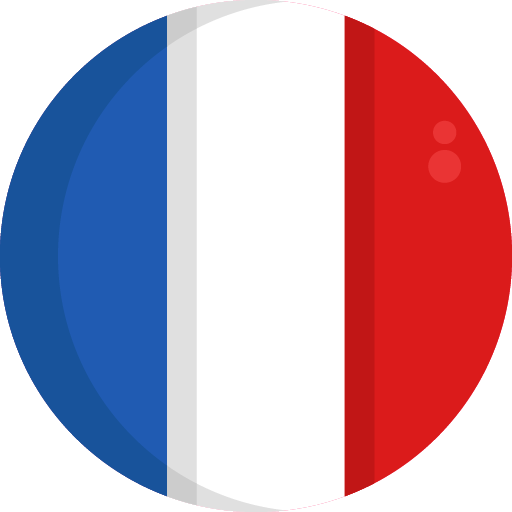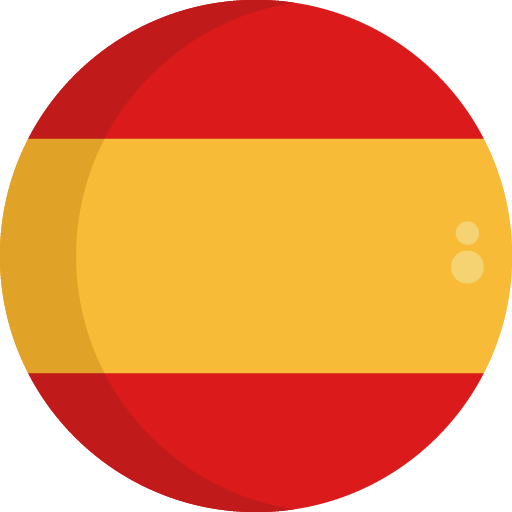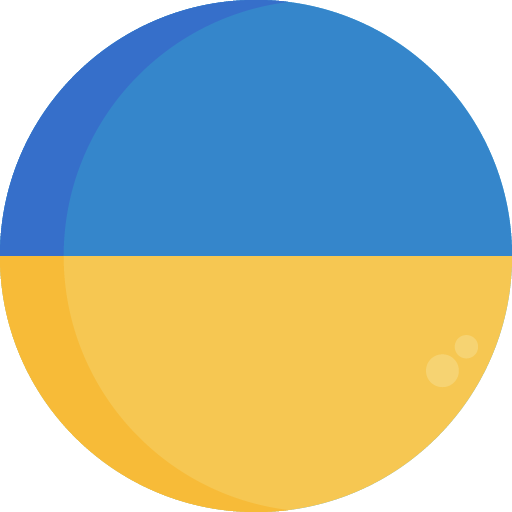Essay #03
Quellenkritik
Matthäus, Markus und Lukas werden in der Neuzeit als die Synoptischen Evangelien bezeichnet, weil sie eine mehr oder weniger gemeinsame Sicht des Lebens von Jesus haben. In der Annahme, dass die weitgehende Übereinstimmung zwischen den drei Evangelien auf eine Art direkter literarischer Zusammenarbeit hinweist, hat ein Großteil der neutestamentlichen Forschung der letzten Jahrhunderte versucht, die Art dieser literarischen Beziehung zu erklären. Ein komplizierender Faktor bei diesen Studien war jedoch eine beträchtliche Anzahl von Fällen, in denen ein Evangelium Dinge anders beschreibt als eines oder beide der anderen Evangelien. Die Schwierigkeit, ein Schema der literarischen Abhängigkeit zu entwickeln, um die Kombinationen von Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten zu erklären, wurde als synoptisches Problem bezeichnet, und der Bereich der Studien, der sich der Lösung dieses Problems widmet, als Quellenkritik.
Das antike Christentum machte sich über diese Schwierigkeit keine Gedanken. Im Allgemeinen ging man davon aus, dass sich die Verfasser der Evangelien auf persönliche Erinnerungen und Berichte aus erster Hand stützten und nicht auf die Schriften anderer oder auf eine gemeinsame schriftliche Quelle. Der Kirchenhistoriker Eusebius wies darauf hin, dass Matthäus, einer der zwölf Apostel, der erste war, der schrieb. Als er im Begriff war, das jüdische Gebiet zu verlassen, lieferte er einen schriftlichen Ersatz für seine mündliche Tätigkeit, die ihrerseits offenbar weitgehend auf seiner apostolischen Erfahrung beruhte. Lukas stützte sich nach eigenem Bekunden (Lk 1,1-4) auf eine Reihe mündlicher und schriftlicher Quellen, von denen keine die Autorität von Matthäus oder Markus besaß. Clemens von Alexandrien sagt, Markus habe sein Evangelium auf die apostolische Überlieferung durch Petrus gestützt. Nur Johannes, der viel später ein Evangelium schrieb, das sich von dem der Synoptiker unterscheidet, war im Besitz der anderen Evangelien, bevor er sie schrieb. Er hätte von ihnen abschreiben können, tat es aber nicht. Stattdessen bestätigte er deren Wahrheitsgehalt und ergänzte sie mit Material, das in den anderen drei Evangelien nicht zu finden war.
Dieser fast einhellige Konsens in der Kirche, dass die Schreiber der synoptischen Evangelien die Werke der anderen nicht kannten, bevor sie sie schrieben, hielt bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts an. Dies änderte sich, als die Gelehrten begannen, verschiedene Hypothesen zu untersuchen, wie ein Schreiber von den anderen abhängig gewesen sein könnte. Auch die Idee von einer einzigen Quelle, die den Evangelisten zur Verfügung stand, wurde geboren. Die Theorien einer einzigen Quelle, die von allen dreien benutzt wurde, und verschiedener Abfassungsreihenfolgen, in denen der zweite Schreiber vom ersten und der dritte von den beiden anderen abhängig war, waren typische Vorläufer der Zwei-Quellen-Theorie, die sich schließlich unter den Neutestamentlern durchsetzte. Diese Theorie geht davon aus, dass Markus zuerst geschrieben wurde und dass Matthäus und Lukas auf dieser Quelle und einer weiteren Quelle namens Q beruhen, die heute nicht mehr existiert.
B. H. Streeters fünf Überlegungen, die er in The Four Gospels: A Study of Origins darlegt, sind die am häufigsten zitierten Argumente für eine frühere Abfassung des Markus. Diese Überlegungen, zusammen mit möglichen Antworten auf jede einzelne, sind:
- Der größte Teil des Markus-Materials (93 Prozent nach Westcott) findet sich bei Matthäus und Lukas. Da es Streeter unvorstellbar erschien, dass Markus die beiden anderen Texte gekürzt haben könnte, kam er zu dem Schluss, dass Matthäus und Lukas Markus erweitert haben müssen.
Es ist anzumerken, dass Markus einen besonderen Grund gehabt haben könnte, eines oder beide der anderen Evangelien zu kürzen. In der Tat zeigt die literarische Praxis in der Geschichte die Tendenz eines Autors, das Werk eines anderen zu kürzen, wenn er es bearbeitet. Wenn es eine literarische Abhängigkeit gab, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Markus das letzte und nicht das erste Evangelium ist, genauso groß, wenn nicht sogar größer.
Eine andere mögliche Antwort setzt keine literarische Abhängigkeit voraus. Es ist denkbar, dass das Material, das zwei oder drei Evangelien gemeinsam haben, auf eine gemeinsame mündliche Überlieferung zurückgeht; in diesem Fall hätte Markus das Matthäus- und das Lukasevangelium nie gesehen, bevor er sein eigenes schrieb, und umgekehrt. - Obwohl Matthäus und Lukas in der Wortwahl oft mit Markus übereinstimmen, stimmen sie nicht überein, wenn sie von Markus abweichen. Wenn man Ausnahmen von dieser Verallgemeinerung zulässt, erklärt Streeter diese Ausnahmen entweder für irrelevant, irreführend, Übereinstimmungen aufgrund von Überschneidungen zwischen Markus und Q (der anderen Hauptquelle von Matthäus und Lukas) oder Übereinstimmungen aufgrund von Textverfälschungen. Die Unterschiede zwischen Matthäus und Lukas werden als Beweis für die Abhängigkeit von Markus angeführt.
Wie die erste Überlegung von Streeter kann auch diese umgedreht werden, um den Vorrang von Matthäus oder Lukas zu beweisen, wenn man eine literarische Abhängigkeit annimmt. Je nachdem, welche Parallelstellen man wählt und welche beiden Evangelien man gegenüberstellt, kann man auch den Vorrang von Matthäus oder Lukas beweisen. Die Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Lukas sind zwar nicht so zahlreich, aber dort, wo Markus etwas anderes sagt, groß genug, um ihre Unabhängigkeit von Markus in fast allen Passagen zu beweisen, in denen sie nach der Zwei-Quellen-Theorie voneinander abhängig sind. Das Fehlen einer überzeugenden Erklärung für diese „Ausnahmen“ zwingt diese Prämisse zum Scheitern.
Es ist auch nicht davon auszugehen, dass die drei Autoren voneinander abgeschrieben haben. Es gab zahlreiche schriftliche und mündliche Berichte über Ereignisse und Reden aus dem Leben Christi, auf die sich die Autoren stützen konnten, ohne voneinander abzuschreiben. Dies ist die plausibelste Erklärung für die zufälligen Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen ihnen: Matthäus und Markus gegen Lukas, Matthäus und Lukas gegen Markus, Markus und Lukas gegen Matthäus. - Die Reihenfolge der Ereignisse bei Markus ist das Original, denn wo Matthäus von Markus abweicht, bestätigt Lukas die Reihenfolge von Markus, und wo Lukas von Markus abweicht, stimmt Matthäus mit der Reihenfolge von Markus überein. Dies, so wird argumentiert, beweise die Priorität des Markusevangeliums, und die beiden anderen Evangelien seien zweitrangig, da sie nie aufeinander folgen, wenn sie von der Reihenfolge des Markus abweichen.
Aber auch hier ist die Schlussfolgerung nicht zwingend. Wenn kopiert wurde, könnte Markus von Matthäus und Lukas abgeleitet worden sein; er könnte ihrer Reihenfolge gefolgt sein, wenn sie übereinstimmten, und dem einen oder anderen von beiden, wenn sie nicht übereinstimmten.
Auch andere Erklärungen sind plausibel. Eine Möglichkeit ist, dass alle drei von einer Reihenfolge ausgingen, die durch eine Tradition vorgegeben war, auf die sich die Augenzeugen geeinigt hatten und die unter den frühen Christen in unterschiedlicher Weise tradiert wurde. Alle drei Autoren wichen dann in ihren Evangelien von dieser traditionellen Reihenfolge ab, wenn sich die Gelegenheit bot. - Der primitive Charakter des Markusevangeliums im Vergleich zu Matthäus und Lukas zeigt den Vorrang des Markusevangeliums. Zur Veranschaulichung: Matthäus verwendet das Wort kurie („Herr“) neunzehnmal und Lukas sechzehnmal, während es bei Markus nur einmal vorkommt. Dies wird als Hinweis auf eine stärker ausgeprägte Ehrfurcht und damit auf eine spätere Entstehungszeit der beiden längeren Evangelien gewertet.
Dieser Beweis wird jedoch entkräftet, wenn man feststellt, dass kurie nicht die behauptete ehrerbietige Konnotation hat, denn Matthäus verwendet diese Anrede siebenmal, wenn er sich auf einen gewöhnlichen Menschen bezieht (Mt 13,27; 21,29; 25,11.20.24; 27,63). Sicherlich war dies keine Anrede, die Matthäus der Gottheit vorbehalten hat. Folglich kann kein chronologisches Argument auf den Gebrauch oder Nichtgebrauch in einem der Evangelien gegründet werden.
Dasselbe gilt für andere angebliche Primitivitätsmerkmale wie die Aramaismen bei Markus. Nach den meisten Kriterien ist Matthäus viel semitischer als Markus. Zusammen mit den Anzeichen für die Spätzeit des Markus (seine Latinismen und seine Übersetzung aramäischer Ausdrücke für diejenigen, die des Aramäischen nicht mächtig waren) gibt es gute Gründe, die Priorität des Matthäus zu postulieren. - Die Verteilung des markinischen und nichtmarkinischen Materials bei Matthäus und Lukas zeigt ihre Abhängigkeit von Markus. Matthäus benutzt Markus als Rahmen und ordnet sein Material in diese Struktur ein, während Lukas markinisches und nichtmarkinisches Material in abwechselnden Blöcken wiedergibt.
Wenn es jedoch literarische Entlehnungen gegeben hat, ist es ebenso vernünftig, das Gegenteil anzunehmen. Anstatt dass Matthäus hier und da Worte oder Sätze herausgreift und sie zu einer glatten und ausgefeilten Erzählung zusammenfügt, ist es ebenso gut möglich, dass Markus bei der Abfassung seiner Erzählung das Buch des Matthäus nahm und Details hinzufügte, um es lebendiger zu machen. Wenn man die Annahme des Vorrangs von Markus aufgibt, kann man zeigen, wie Lukas Teile von Matthäus und Markus wiederum Teile von Lukas übernommen haben könnten.
Eine andere mögliche Erklärung ist, dass alle drei aus einem gemeinsamen Traditionskern der frühen Christen geschöpft haben könnten.
Die von Streeter vertretene Zwei-Quellen-Theorie genießt zwar seit langem breite Akzeptanz, setzt aber in einigen Fällen den zu beweisenden Sachverhalt voraus und beruht in anderen Fällen auf übertriebenen Verallgemeinerungen, die wesentliche Ausnahmen außer Acht lassen. Seine Argumentation stößt daher zunehmend auf Widerstand. Nach dem Rückgang von Streeters Anhängern haben andere Verfechter des märkischen Vorrangs Argumente zur Stützung dieser Theorie vorgebracht, aber keiner dieser Versuche reichte aus, um nennenswerte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Abgesehen davon, dass die Beweise für die Zwei-Quellen-Theorie schwach sind, steht sie in direktem Widerspruch zu dem einhelligen Zeugnis von mehr als achtzehnhundert Jahren christlicher Geschichte, dass Matthäus das erste Evangelium war, das geschrieben wurde. Dass der Apostel dieses Namens vor seinem griechischen Evangelium ein aramäisches Werk verfasst hatte, interessierte die frühen Väter nicht. Sie scheinen die griechische Schrift als natürliche Fortsetzung der aramäischen Schrift betrachtet zu haben, die geschrieben wurde, nachdem Matthäus das jüdische Gebiet verlassen hatte, um unter nichtaramäisch sprechenden Menschen zu wirken. Zusammen mit den inhärenten Schwächen, die für Markus und Q als Quellen für Matthäus und Lukas sprechen, hat dies zu einer wachsenden Opposition geführt, die die Gültigkeit der Zwei-Quellen-Theorie in Frage stellt. Fünf der auffälligsten Schwächen der Theorie sollen hier genannt werden:
- Die Zwei-Quellen-Theorie kann die so genannte „große Auslassung“ nicht erklären. Wenn Lukas Markus als Quelle benutzt hat, dann gibt es keine vernünftige Erklärung dafür, warum er alle Verweise auf Markus 6,45-8,26 ausgelassen hat. Dieser wichtige Abschnitt enthält wie Jesus auf dem auf dem Wasser geht, die Heilung in Genezareth, einen großen Konflikt über die Tradition der Ältesten, den Glauben der syrophönizischen Frau, die Heilung eines Taubstummen, die Speisung der Viertausend, die Forderung der Pharisäer nach einem Zeichen, die Lehre über den Sauerteig der Pharisäer und den des Herodes sowie die Heilung eines Blinden in Bethsaida. Auch wenn Lukas Gründe gehabt haben mag, einen so langen und zusammenhängenden Abschnitt auszulassen, ist es doch wahrscheinlicher, dass ihm das Markusevangelium nicht zur Verfügung stand, als er es schrieb.
- Jüngste archäologische Entdeckungen und ein wachsendes Wissen über die jüdischen Verhältnisse im ersten Jahrhundert haben es immer schwieriger gemacht, das Argument aufrechtzuerhalten, dass es sich bei Q um eine einzige schriftliche Überlieferung handelt. Alte historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass die Überlieferungen an diesem Ort keine Tendenz zur Vereinheitlichung aufwiesen, sondern sich eher zufällig vermehrten. Sie verschmolzen nicht zu einem einheitlichen Ganzen.
Wenn man Q als einzige schriftliche Quelle betrachtet, sind die von Matthäus und Lukas vorgenommenen Änderungen anormal. Versuche, die angebliche Verwendung dieser Quelle durch diese beiden Autoren zu analysieren, scheitern am Fehlen eines einheitlichen rationalen Verfahrens.
Wenn das Symbol Q beibehalten werden soll, was zweifelhaft ist, ist es befriedigender, es als Material des Evangeliums zu erklären, das zu vielen verschiedenen schriftlichen und mündlichen Überlieferungssträngen gehört. Es ist alles andere als homogen und hat keine definierbaren Grenzen. Da die Zwei-Quellen-Theorie von einem homogenen Q ausgeht, wird sie durch eine solche Neudefinition von Q im Wesentlichen widerlegt. - In den Abschnitten der dreifachen Überlieferung (d.h. diejenigen, die von Matthäus, Markus und Lukas abgedeckt werden) unterscheidet sich eine beträchtliche Anzahl (etwa zweihundertdreißig) zwischen Matthäus und Lukas und einem parallelen Abschnitt bei Markus. („unterscheidet“ bedeutet nicht, dass Markus den beiden anderen widerspricht, sondern dass sein Wortlaut anders ist). Diese Übereinstimmungen sind zwar nicht so zahlreich wie die Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Markus, wo Lukas abweicht, und zwischen Markus und Lukas, wo Matthäus abweicht, aber sie sind ausreichend, und ihre Anordnung ist so, dass sie eine andere gemeinsame Quelle als Markus für Matthäus und Lukas beweisen. Zum Beispiel stimmen Matthäus 9,1-8 und Lukas 5,17-26 in neun verschiedenen Ausdrücken wörtlich überein, während Markus 2,1-12 in seinen Parallelen einen anderen Wortlaut aufweist. In Matthäus 8,1-4 und Lukas 5,12-16 finden sich sieben identische Wörter oder Ausdrücke, von denen Markus abweicht. Für sich genommen könnten diese Übereinstimmungen vielleicht als Zufall oder Textverfälschung erklärt werden, aber wenn man ihre Nähe zueinander betrachtet, wird die Möglichkeit eines Zufalls ziemlich unwahrscheinlich. Tatsache ist, dass die Zwei-Quellen-Theorie solche Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Lukas nicht erklären kann, wenn Markus anders liest.
Die ersten drei Schwächen sollten für Menschen aller theologischen Überzeugungen, einschließlich der extrem liberalen, offensichtlich sein. Die letzten beiden Schwächen haben besondere Auswirkungen auf die evangelikale Sichtweise: - Der Vorrang von Markus stellt eine ernsthafte Herausforderung für das bisher unangefochtene Zeugnis des Urchristentums dar, dass der Apostel Matthäus das erste Evangelium geschrieben hat. Es fordert die Annahme, dass Matthäus, ein Augenzeuge des Wirkens Jesu, für seine Informationen auf Markus, einen Nicht-Augenzeugen, angewiesen war. Diese Abhängigkeit geht sogar so weit, dass sich Matthäus bei der Beschreibung seiner eigenen Bekehrung auf Markus stützt! Selbst wenn man Letzteres ausschließt, ist eine solche Abhängigkeit unwahrscheinlich, selbst wenn Markus den hoch angesehenen Petrus als Quelle hatte. Es läuft darauf hinaus, entweder das zu akzeptieren, was die frühen Väter über die matthäische Autorschaft sagten, oder die „Erkenntnisse“ des Rationalismus des 19. Jahrhunderts zum akzeptieren. Letzterer, der sich nicht um die Beibehaltung der matthäischen Autorschaft des Matthäus kümmerte, setzte die Abfassung des ersten Evangeliums viel später als das traditionelle Datum der Abfassung an, sogar im zweiten Jahrhundert. Bei einer solchen Wahl liegt die Wahrscheinlichkeit der Genauigkeit auf der Seite der Alten Kirche, da diese Generation der Kirche viel näher stand und Zugang zu besseren Informationen über die Verfasserschaft der Evangelien hatte. Es gibt keinen triftigen Grund, an der Richtigkeit dieser antiken Quellen zu zweifeln, so dass die Zwei-Quellen-Theorie auch in anderer Hinsicht zu kurz greift.
- In der Zwei-Quellen-Theorie werden die persönlichen Kontakte zwischen den Synoptikern nicht ausreichend berücksichtigt. Sofern man die traditionelle Autorenschaft der drei Synoptiker nicht ablehnt, muss man sich von den Möglichkeiten beeindrucken lassen, die den drei Verfassern zur Verfügung standen, um Informationen über das Leben Christi mündlich auszutauschen, ohne auf eine Form der dokumentarischen Abhängigkeit zurückgreifen zu müssen. Matthäus und Markus müssen unmittelbar nach Pfingsten enge Freunde gewesen sein, und die Jerusalemer Christen nutzten das Haus des Markus als Treffpunkt (vgl. Apg 12,12). Markus und Lukas arbeiteten während der Gefangenschaft des Paulus in Rom zusammen (Kol. 4,10.14; Philem. 24). Es ist möglich, dass Lukas Matthäus während seines zweijährigen Aufenthaltes bei Paulus in Israel in den späten 50er Jahren n. Chr. kennenlernte (vgl. Apg 24,27). Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, so muss er im Zuge seiner Evangelienforschung mit einigen Personen gesprochen haben, die Matthäus nahestanden. Solche persönlichen Kontakte machen die von der Zwei-Quellen-Theorie vertretene literarische Abhängigkeit überflüssig.
Diese und andere Schwächen zeigen die Unzulänglichkeit der Zwei-Quellen-Theorie und haben dazu beigetragen, dass sie in jüngster Zeit an Popularität verloren hat. Es hat sich keine Theorie herauskristallisiert, die sie ersetzen könnte, aber ein Ansatz, der die Evangelien als unabhängige Einheiten behandelt, gewinnt zunehmend an Attraktivität. Dieser Ansatz ist nicht nur aufgrund der angeführten Beweise überlegen, sondern auch, weil er die Tradition des antiken Christentums bestätigt: Jedes der drei synoptischen Evangelien ist unter relativ unabhängigen Umständen entstanden. Die Schreiber tauschten wahrscheinlich Informationen durch persönliche Kontakte aus, aber jeder hatte andere Informationsquellen als die beiden anderen. Die Kontakte des Matthäus mit Jesus waren hauptsächlich persönlich. Markus’ Kontakte liefen hauptsächlich über Petrus und seine möglichen Erlebnisse als einer der 72 gesandten Jünger. Lukas nutzte das, was er durch Gespräche und genaue schriftliche Aufzeichnungen in Erfahrung bringen konnte (auch er könnte einer der 72 gesandten Jünger gewesen sein). Alle drei stützten sich in hohem Maße auf verschiedene mündliche Überlieferungen, die sich durch die konzentrierte nachpfingstliche Verkündigungstätigkeit der ersten Christen rund um Jerusalem rasch ansammelten. Die ständige Wiederholung, die sich an einen vom Heiligen Geist erweckten Geist richtete (Joh 14,26; 16,13), war mehr als ausreichend, um die große Zahl von Übereinstimmungen in den synoptischen Evangelien zu erklären. Es war nicht notwendig, dass die Verfasser die Werke der anderen kannten oder dass alle drei auf eine oder zwei gemeinsame Quellen zurückgriffen. Die Entstehungszeiten und -orte waren so weit gestreut, dass alle drei als unabhängige Zeugen des Lebens Jesu angesehen werden konnten.
Dr. Robert L. Thomas
Dr. Stanley N. Gundry
Weiterführende Literatur
Albright, C. F., and C. S. Mann. Matthew. Vol. 26 of The Anchor Bible. Garden City, NY: Doubleday, 1971. Pp. xix-cxcvii.
Bellinzoni, Arthur J. The Two-Source Hypothesis. Macon, GA: Mercer University Press, 1985.
Boismard, M.-E. “The Two-Source Theory at an Impasse,” New Testament Studies 26 (1980): 1-17.
Cole, R. A. The Gospel According to Mark. The Tyndale New Testament Commentaries. Grand Rapids: Eerdmans, 1961. Pp. 23-48.
Dyer, Charles H. “Do the Synoptics Depend on Each Other?” Bibliotheca Sacra 138 (1981): 230-45.
Farmer, William R. The Synoptic Problem. New York: Macmillan, 1964. Pp. 1-198.
Farmer, William R., ed. New Synoptic Studies. Macon, GA: Mercer University Press, 1983.
Fuller, Reginald. “What Is Happening in New Testament Studies?” St. Luke’s Journal of Theology 23 (1980): 90-100.
Hiebert, D. Edmond. An Introduction to the New Testament: The Gospels and Acts. Vol. 1. Chicago: Moody, 1975. Pp. 160-90.
Lowe, Malcolm. “The Demise of Arguments from Order for Markan Priority,” Novum Testamentum 24 (1982): 27-36.
Maier, G. The End of the Historical-Critical Method. Translated by E. W. Leverenz and R. F. Norden. St. Louis: Concordia, 1977.
Pamphilus, Eusebius. The Ecclesiastical History of Eusebius Pamphilus. Translated by Christian Frederick Cruse. Grand Rapids: Baker, 1955. Pp. 12-478.
Rist, J. M. On the Independence of Matthew and Mark. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
Sanders, E. P. “New Testament Studies Today,” Colloquy on New Testament Studies. Edited by Bruce C. Corley. Macon, GA: Mercer University Press, 1983. Pp. 11-28.
____. The Tendencies of the Synoptic Tradition. Cambridge: Cambridge Uni-versity Press, 1969. Pp. 1-285.
Stein, Robert H. The Synoptic Problem. Grand Rapids: Baker, 1987.
Stoldt, Hans-Herbert. History and Criticism of the Marcan Hypothesis. Macon, GA: Mercer University Press, 1980.
Streeter, B. H. The Four Gospels: A Study of Origins. London: Macmillan, 1936. Pp. 150-360.
Styler, G. M. “The Priority of Mark,” The Birth of the New Testament. Edited by C. F. D. Moule, 3rd ed. San Francisco: Harper & Row, 1982. Pp. 285-87, 288-90.
Thomas, Robert L. “An Investigation of the Agreements Between Matthew and Luke Against Mark,” Journal of the Evangelical Theological Society 19 (1976): 103-12.
____„The Rich Young Man in Matthew,” Grace Theological Journal 3 (1982): 235-60.
Walker, William 0., ed. The Relationships Among the Gospels. San Antonio: Trinity University Press, 1978.
Wenham, David. “The Synoptic Problem Revisited: Some Suggestions About the Composition of Mark 4:1-34,” Tyndale Bulletin 23 (1972): 3-38.